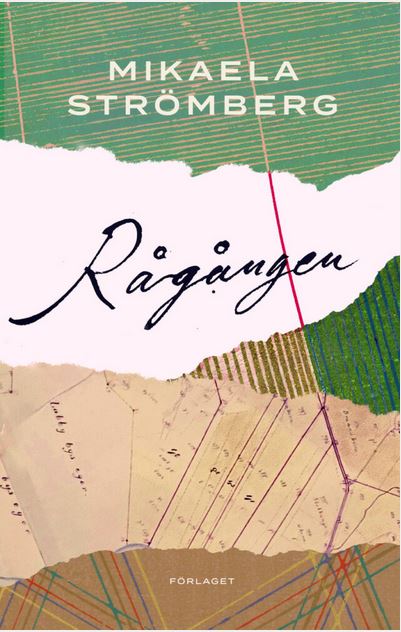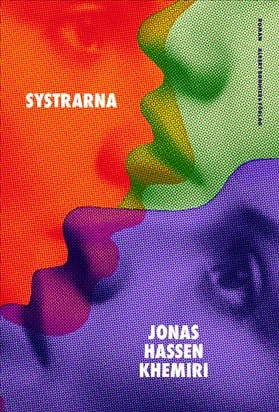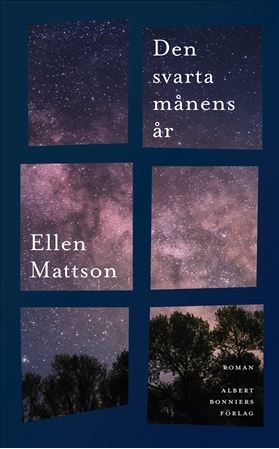Mikaela Strömberg: Rågången. Helsingfors: Förlaget, 2023.
Git Laudrup hat bisher ein vorhersehbares Leben im finnischen Esbo geführt, in einem sicheren Anstellungsverhältnis an der Landvermessungsbehörde. Sie und ihr gutmütiger Ehemann Måsse gehen auf die 60 zu, als sich Git während der Pandemie etwas ruckartig für einen Berufswechsel entscheidet. An dem satirisch dargestellten neuen Arbeitsplatz, einem Advokatenbüro, kommt es zu einem sprichwörtlich handgreiflichen Konflikt, und Git wird wegen der gegen sie erstatteten Anzeige auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Dies ist der etwas holprige Auftakt des Romans Rågången (in etwa Grenzklärungsgang) und die von Zufällen begünstigte Rechtfertigung dafür, dass die ansonsten so nüchterne und strukturiert vorgehende Git in einem Abenteuer mit offenem Ausgang landet.
Kindheit und Jugend hat die Protagonistin im (fiktiven) Dorf Starrängarna (´Starenwiesen‘) in Östnyland, der Region um Helsinki, verbracht, bevor sie im dänischen Århus ihre allseits respektierte Ausbildung absolvierte und wieder nach Finnland zog. Sie bewegt sich in einem finnlandschwedischen Milieu, ohne dass der Sprachgebrauch eigens erwähnt wird. Gits Dänischkenntnisse sind allerdings unverzichtbar im Umgang mit dem Vater, der vom Altenpflegepersonal in Esbo nicht mehr verstanden wird. Der realistische, oft satirisch zugespitzte kleine Roman Rågången unterläuft mit dieser Konstruktion die erwartbaren soziokulturellen, nationalen bzw. minoritätssprachlichen Differenzen. Dabei kann Git durchaus als leicht anschlussfähige Angehörige einer zweiten Zuwanderungsgeneration aufgefasst werden.
Die Pflege von Anachronismen
Eine nicht zu unterschätzende Pointe des Romans besteht darin, dass das Wort „rågången“ laut Svenska Akademiens Ordbok nicht mehr gebräuchlich ist (https://saob.se/artikel/?unik=R_3543-0057.n7o3&pz=5 ). Das Wort ist mit dem Zeichen † markiert. Die vielfältigen Grenzklärungen, welche die Figuren, die juristischen Konflikte und die Dorfgeschichte betreffen, werden damit als Analogien zu sprachlichen Anachronismen dargeboten. Während die Grenzkonflikte in mehrfacher Bedeutung genutzt und damit auch negativ aufgeladen sind, dominiert in vielen Dorfschilderungen eine musealisierende Attitüde, wie etwa in der Schilderung der Spazierfahrten mit dem Pferdegespann, die der Bauer Riåkarn unternimmt:
„Den här gubben som åker runt med sin häst. En gammal vallack. Men för att vara ärlig är den ingen krake. Gubben har haft koll på hur en häst skall skötas. Den där kunskapen försvann aldrig, och varför skulle den försvinna. Det är väl som att cykla.
Så där vill man att hästar skall se ut, passliga i hullet, pigga och med skötta hovar.“ (S. 106)
„Dieser alte Mann, der mit dem Pferd herumfährt. Ein alter Wallach. Aber um ehrlich zu sein, ist es kein Klepper. Der alte Mann hat immer gewusst, wie ein Pferd zu pflegen ist. Diese Kenntnisse sind nie verlorengegangen, und warum sollten sie das auch. Es ist wie beim Fahrradfahren.
So sollten alle Pferde aussehen, gestriegeltes Fell, munter und mit gepflegten Hufen.“
Indem der Umgang mit Pferden zur Körpertechnik deklariert wird, scheint einerseits die automobilfreie präkapitalistische Idylle auf, die sofort durch Gits Begeisterung für das Autofahren wieder aufgefangen wird. Andererseits wird der Entschleunigungsbedarf der Zivilisationsgeschädigten illustriert, ein bekanntes soziales Phänomen, das sich in Folge der Pandemie verstärkt hat und wahlweise die Uckermark, die Provence, Oslo Marka oder eben in die dünn besiedelten Gebiete Nylands im Südosten Finnlands betrifft. Die Dorfkultur wiederzubeleben heißt dann bezeichnenderweise auch, sich selbst mit unerprobten Ressourcen auszustatten, um zur Besinnung zu kommen – vielleicht doch eher ein subjektives als ein gemeinschaftliches Projekt?
Mikaela Strömberg, heute als Schriftstellerin und Juristin tätig, ist für ihre ländlichen, bisweilen harmonisierenden oder historisierenden Schilderungen der ausgestorbenen Dörfer in Östnyland seit 2000 bekannt, als sie den Preis der Schwedischen Literaturgesellschaft in Finnland für ihr Debüt erhielt. Die Revitalisierung dörflicher Gemeinschaften ist ihr zweifellos ein Anliegen.
Muster(v)erkennung
Die Kombination von Erwartbarem und Zufälligem kann dazu führen, dass unerwartete Ereignisse eintreffen oder gängige Muster unterlaufen werden. Dies mag neben der erheiternden Hauptfigur in der Doppelkrise auch das Umschlagbild von Rågången veranschaulichen: Eine historische topographische Karte, wenn auch in graphisch verfremdeter Form, die Besitzrechte und Territorialität fokussiert. Auf dem unteren bräunlichen Kartenblatt sind Flächenangaben und Grenzlinien zu erkennen, einige Äcker und Weideflächen tragen schwedische Eigennamen (Brännåkern, Ängråkern, Stobbån, Tistelängen). Die physische Buchausgabe und die Abbildung der Verlagswerbung im Internet weisen eine bemerkenswerte Abweichung auf: Während der konkrete Bucheinband nur den Eintrag „[…] bys egor“ (Eigentum des Dorfes xy) zeigt, wurde bei der digitalen Abbildung der Ausschnitt etwas verschoben, so dass das ansonsten fiktive Dorf nun doch geographisch lokalisierbar wird: „Labby bys egor“, historisch belegt seit Mitte des 16. Jahrhunderts (siehe https://bebyggelsenamn.sls.fi/bebyggelsenamn/2133/labby-lovisa/). Dieser Ort liegt rund 100 km von Esbo entfernt, was übrigens die seltene Anwesenheit von Gits berufstätigem Ehemann erklärt.
Gerade das auf dem Bild links unten dargestellte Gebiet für die gemeinschaftliche Nutzung, die Fläche im Dorfeigentum, die nicht weiter aufgeteilt werden darf, ist metaphorisch bedeutsam für die Verheißung ländlicher Gemeinschaft, die bei Strömberg zwar beschworen, aber nur in den erzählerisch synthetisierten Erinnerungen realisiert wird – sowohl auf Seiten der Figuren als auch im schlingernden Erzählprozess.
Die obere grüngestreifte Hälfte des Titelblatts verweist auf Wald oder nicht erschlossenes Gebiet. Zwischen den beiden Hälften ist ein weißer Riss zu erkennen, in dessen Mitte der schwungvolle, nach schräg oben strebende Schriftzug „Rågången“ prangt. Eine markante Linie durchzieht und verbindet beide Bildhälften, wobei sie auf dem weißen Grund rot eingefärbt ist. Diese Linie verweist offensichtlich nicht auf eine Grenze, sondern auf eine Route. Auf das farbig hervorgehobene Intervall zwischen Möglichkeit und Zweckbestimmung – oder umgekehrt zwischen vorausschauender Strukturiertheit und sich chaotisch ansammelnden Erfahrungen, die sämtliche Zeitstufen betreffen – kommt es in Rågången also an, angeblich in der Landschaft wie im Leben.
Die übertragene Bedeutung bestätigt sich, indem die vertikale rote Linie die Endsilbe des Titels durchstreicht: Es geht um Lebensbilanzen mit integrierten Grenzverlaufsklärungen (im Sinne von „rågång-rannsakning“ laut SAOB), im Besonderen und im Allgemeineren.
Retrospektiv Sicherheit gewinnen und unlösbare Fragen aufwerfen
Die dänisch-finnlandschwedische Git ermöglicht in ihrer professionellen Position als juristisch befugte Landvermesserin die Beilegung eines Grenzstreits in Starrängarna. Mit dem habgierigen Waldbesitzer Raymond S. Markelund (man beachte die sprechenden Namen) führt sie einen Grenzgang durch, bei dem es zu zwei überraschenden Funden kommt. So findet sie eine im Boden verankerte alte Steinröse, die den genauen Verlauf der Grenze rechtssicher festlegt. Markelunds dreiste Landnahme, die sich auf aktuelle GPS-Kartendaten beruft, kann daher abgeschmettert werden. Mit dieser materiell anschaulichen Rückverlängerung der Dorfgeschichte kommt ein erinnerungspolitischer Appell des Romans zum Ausdruck, und ganz beiläufig wird mit dem Kartenumschlagbild die schwedische Vorgeschichte eines Teils des finnischen Staatsgebiets ins Gedächtnis gerufen.
Bei dem Grenzgang wird außerdem die Leiche von Pekka Riåkarn entdeckt. Der unaufgeklärte Todesfall bildet ersatzhaft einen roten Faden für die Episoden rund um die Dorfbewohner, die Git meist von einem neu gewonnenen Freund, Bernt, übermittelt werden. In den Gesprächen während der Renovierungsarbeiten von Gits kleinem Hof (einem Torp) kehrt Bernt immer wieder auf die Ereignisse rund um den Leichenfund und auf das Schicksal der Familie Riåkarn zurück, Bernt gehört ebenfalls der Heimkehrer-Generation an.
Eine allwissende, kommentierende, mitunter zu scherzhaften Bemerkungen aufgelegte Erzählinstanz sorgt für eine konzeptuelle Mündlichkeit des Erzählens. Dies macht den Unterhaltungswert aus, der meiner Einschätzung eine deutsche Übersetzung von Rågången erwarten lässt – eventuell sogar im Fahrwasser der Erfolge von Dörte Hansens Mittagsstunde (2018; siehe Hansens Thema der Flurbereinigung, d.h. der Anpassung von Gemeindegrenzen und der modernisierenden Umgestaltung von Knicklandschaften im 20. Jahrhundert).
Zur Figurengalerie gehören neben der Ehefrau auch die Töchter der Bauernfamilie Riåkarn, Pee und Emm genannt, die ihren inzwischen verwitweten alten Vater immer häufiger besuchen. Für die gesamte Familiengeschichte ist die anspruchslose Zuwanderin Laila aus Uleåborg wichtig, mit ihr hatte Pekka ein kurzes Glück erlebt, bevor er wieder psychisch erkrankte und im Alter von 40 Jahren im Moor umkam. Es ist nicht ausgeschlossen, dass mit dieser intuitiv begabten Viehwirtschafterin Laila, der schwarzhaarigen Schönheit aus dem hohen Norden Stereotype der Alterität, nicht zuletzt von indigener Naturverbundenheit aufgerufen werden. Bernt weiß zu berichten, dass das Ehepaar Riåkarn den Kontakt zu Laila hielt, nachdem diese mit ihrem fast neugeborenen Enkel plötzlich abgereist war. Die näheren Umstände von Pekkas Ableben bleiben dennoch ungeklärt. Als bei der Abwicklung des Hofes die namentlich bekannten Kühe verabschiedet werden, reagieren auch die mittlerweile stadtorientierten Schwestern Pee und Emm betroffen.
Logbuch Romanbaustelle
Git lässt sich in Starrängarna treiben, gewinnt Abstand und richtet sich im Renovierungsprovisorium ein, so wie die Lesenden angehalten sind, die locker gefügten Plauderepisoden spekulativ zusammenzuführen. Zwischen den Zeitstufen der Dorferinnerungen wird hin- und hergeschaltet: „Allt som kraschade“ (Alles was zusammenbrach, S. 167), „Bygget logg höst 2“ (Die Baustelle im Herbst 2, Loggbuch, S. 141), „Mormor, det vill säga Momi från kyrkbyn“ (Großmutter, besser gesagt Omi aus dem Kirchspiel, S. 116).
Gemeinschaft entsteht dem Roman zufolge nicht allein durch Gespräche, Überlieferung, Spekulationen und Dorftratsch, sondern auch durch gemeinsames Schweigen. Als Bernt Git anvertraut, dass er vielleicht – den Eltern oder sich selbst zuliebe – doch früher nach Starrängarna hätte zurückgehen gehen sollen, spielt sich die folgende etwas zähe Szene ab:
„ – Jag borde kanske ha kommit hem då, sa Bernt.
Men så lämnade han temat. Han satte ytterligare en sockerbit i sitt kaffe, han var lite udda på det viset att hans rutiner varierade. Ibland var det en bit, ibland två, ibland till och med inget socker alls. Men sätter man två bitar så måste man röra lite extra. Git hade lust att fråga lite mer om det där eventuella kommandet, men det var kanske känsligt, eller något han inte ville diskutera. Då er det förstås bäst att man är tyst. Git suckade, det var här med det eviga snöandet också, mitt i allt hade det börjat vräka ner fast det egentligen var höst enligt almanackan.“ (S. 155)
„- Ich hätte vielleicht schon damals heimkommen sollen, sagte Bernt.
Aber dann ging er nicht mehr auf das Thema ein. Für seinen Kaffee nahm er noch ein Stück Zucker, er war etwas eigenartig in seinen Gewohnheiten. Manchmal nahm er ein Stück, mal zwei oder gar keinen Zucker. Wenn man zwei Stücke nimmt, muss man den Kaffee etwas länger umrühren. Git hätte gerne mehr zu dieser eventuellen früheren Heimkehr gefragt, aber vielleicht war das ein heikles Thema oder eine Sache, zu der er sich nicht austauschen wollte. Dann ist es natürlich besser, nichts zu sagen. Git seufzte, und dann auch noch dieser ewige Schnee, in all dem hatte es losgeschneit, obwohl laut Kalender Herbst war.“
Im letzten Abschnitt erfährt Pee von ihrem Vater, wer den Anbau des kleinen Nachbarhofs im dänischen Sommerhausstil umgestaltet hat: „- En lantmätare, så Riåkarn, här från mejeriet.“ (Eine Landvermesserin, sagte Riåkarn, hier von der Molkerei, S. 222)
Erst an dieser Stelle deutet sich der mögliche Beginn eines intensiveren Kontaktes zwischen den Ortsansässigen und den Zugewanderten an, der über die Vertrautheit mit der Dorfgeschichte legitimiert wird. Die Anwendung von Regiolekt und Soziolekt in den Dialogen legt nahe, dass Kriterien von Herkunft und Abstammung bzw. von nachweislicher ländlicher Sozialisation Voraussetzungen für soziale Anerkennung bleiben.
Auch wenn einige Höfe verlassen und die ehemalige Molkerei stillgelegt bleiben werden, scheinen das Teilen von gruppenspezifischen Geschichten und eine geteilte Historiographie am ehesten eine Selbstidentifikation als Bestandteil einer Gemeinschaft zu ermöglichen, ein Selbstverständnis, das städtische Lebensformen – frei nach dem Konzept von Ferdinand Tönnies 1887 – nicht bieten könnten.
Die nostalgische Wehmut und die engagierte regionale Geschichtsvergewisserung im Hinblick auf die Abwanderungsgebiete, die seit der Pandemie aufgewertet wurden, sollen offenkundig tröstenden Halt in unübersichtlichen Zeiten bieten. Vielleicht wird sogar im zweiten Band, falls es diesen geben sollte, Gits jütländischer Käse verkostet?
(Antje Wischmann, Universität Wien)