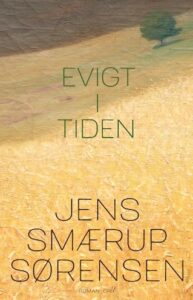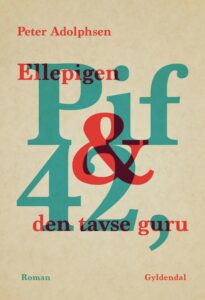Zu Jon Fosses Ein Leuchten (Kvitleik 2023), Tief im schwarzen Wald (I svarte skogen inne 2023) und „Leike leiken“ (Spielen spielen 2023)

Die Aufregung über den Literaturnobelpreis an Jon Fosse 2023 hat sich inzwischen gelegt. Mittlerweile sind viele Lesende vielleicht schon neugierig auf die nächste Preisverkündung im Oktober 2024. Trotzdem lohnt es sich, einige jüngst erschienene Texte des Autors, die bisher wenig beachtet wurden, näher zu betrachten und ein wenig über das Schreiben und das ‚Text-Erleben‘ nach dem Nobelpreis zu spekulieren: Im Hinblick auf mediale Umsetzungen und Adaptionen zeichnet sich nämlich ein vielversprechender Trend für die Formate der szenischen Lesung und des Hörspiels ab, auch wenn die Neu- oder Re-Inszenierungen von Fosses Arbeiten an den europäischen Bühnen insgesamt noch eher zäh anlaufen.
Aktiv in mindestens drei Genres
Die Auszeichnung wurde von der Schwedischen Akademie damit begründet, dass Fosses „Neuland betretende Dramatik und Prosa dem Unsagbaren eine Stimme gibt“ („för att hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara“ (https://nobelprizemuseum.se/litteraturpriset-2023).
Dem „Unsagbaren eine Stimme zu geben“ ist eine gewagte Metaphorik, etwas raunend oder bewusst vage gehalten, wie um die religiöse Thematik mit einzubeziehen. Die vom Komitee in der Begründungsformel pointierte Stimme bezieht sich dabei weniger auf die Stimme einer Figur oder auf Erzählperspektiven, sondern auf eine sich manifestierende Kraft, die etwas Verborgenes freilegt und es der Wahrnehmung zumindest ansatzweise zugänglich macht. Eine solche Erschließung kann nur im Vollzug, d.h. während der Lektüre oder während einer Theateraufführung stattfinden, wenn sich nämlich die Texte ereignen. Doch selbst wenn für die Dauer der Rezeption assoziative Bedeutungen freigesetzt werden, die Fosse-Interessierte ‚musikalisch‘ ansprechen oder atmosphärisch in ihren Bann ziehen, kommt meistens kein Pathos auf. Zentrale Themen und Motive, Figuren oder Requisiten sind im Laufe der Zeit in Fosses Werk so oft wiederholt, abgewandelt und neu arrangiert worden, dass sie sich gleichsam abgeschliffen haben und sogar zitathaft wirken können.
Der historische Erfolg der Dramen wird mit dieser Formel hervorgehoben, ebenso der Meilenstein in Gestalt der Heptalogie, eines siebenteiligen Künstler- bzw. Bildungsromans (2019-23), der zeitlich nah am Jahr der Auszeichnung liegt. Während das Nobelkomitee Fosses Rang als Dramatiker und Prosaist betont und mit dem ‚Vernehmbar-Machen‘ des Unsagbaren auch die einkreisenden Verfahren von Wiederholungen und Pausen berücksichtigt, bleibt das lyrische Werk in der Begründung ausgespart. Dies ist verwunderlich, denn Fosses poetische Produktion reicht von den Lyrics in der Initialphase als Rockmusiker bis zu seinem mitunter explizit mit religiösen Fragen befassten ‚Alterswerk‘, in dem hin und wieder Anleihen bei der Kirchenlieddichtung genommen werden. Angesichts der Schlüsselfunktion von Rhythmus und Klang in Drama und Prosa wäre es gerechtfertigt, von einer Art lyrischem Substrat in Fosses Gesamtwerk auszugehen. Oft kommt in allen drei Genres eine inszenierte Mündlichkeit zum Einsatz, die den gedruckten Text als dürres Ausgangsmaterial erscheinen lässt, das ohnehin erst beim Vorlesen, im szenischen Spiel oder auf der Theaterbühne zum Leben erweckt wird. Ein solches tastendes, aus sich selbst Hervorschreiben führt die Lyrik seit jeher plastisch vor, unabhängig davon, wie sich die Lesenden das lyrische Ich im Einzelnen vorstellen.
Für den Trend zum Ohrentheater spricht beispielsweise, dass in den Wochen direkt nach der Preisverleihung häufig Hörbücher oder Hörspiele zugänglich waren, während viele ältere Werk erst wieder neu aufgelegt oder nachgedruckt werden mussten. Der Deutschlandfunk Kultur stellte beispielsweise die Hörspielfassung von Eg er vinden (Ich bin der Wind; https://www.hoerspielundfeature.de/ich-bin-der-wind-102.html) bereit, des letzten Dramas ‚der ersten Staffel‘, d.h. vor der biographischen Zäsur 2011/12 und vor dem Prosa-Durchbruch mit Trilogien (Trilogie 2015) verfasst, mit dem Preis des Nordischen Rates ausgezeichnet, ein gemessen an der Heptalogie schmaler Prosaband. Im schwedischen Buchhandel war im Herbst 2023, extrem willkürlich, lediglich das Hörbuch Hundmanuskripten (Hundemanuskripta 1-3) für Kinder erhältlich, dies ein eher schwächeres Auftragswerk, dessen norwegische Einzelbandtitel aber gut zur Pointe über den grundsätzlichen poetischen Performativitäts-Appell bei Fosse passen: Nei å nei, Du å du, Fy å fy (1995-97).
Die drei Genres bedingen einander, und die entstehenden Genrekombinationen regen intermediale Umsetzungen gerade an, wie ich in dieser Sammelrezension erläutern werde.
Vom Groove getragen
Die von Uwe Englert herausgegebene Anthologie Das Gras hinter dem letzten Haus. Neue Literatur aus Norwegen (2019) enthält sechs Fosse-Gedichte, und die zweisprachige Sammlung Diese unerklärliche Stille (Denne uforklarlege stille 2016, Kleinheinrich Verlag Münster) präsentiert eine umfassende Auswahl, jeweils übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel, der im deutschsprachigen Raum beinahe zu Fosses Ko-Autor avanciert ist. Fosse zu Unrecht wenig beachtete Lyrik etabliert ein konzentriertes Repertoire an Schlüsselbegriffen, wie etwa bestimmte Szenographien, Stimmungen oder Farben, deren Bedeutungsspektrum in der kleinen Form variabel und beweglich bleibt.
Zugespitzt formuliert: Poetische Verfahren sind konstituierend für Dramen und Erzähltexte, womöglich ein allgemeiner konzeptueller Ausgangspunkt. Wie Englert anmerkt, ist die Formulierung der schwedischen Autorin Kristina Lugn „Die Lyrik ist sowohl Haupteingang als auch Bühneneingang für seine Dramatik“ („Poesin är både huvudentré och sceningång till hans dramatik“, 2007) an Anschaulichkeit nicht zu übertreffen.
In der Presse wurde der „Fosse-Sound“ erwähnt, der beim Lesen einen Sog, eine Art Begleitspannung zu den oft ereignisarmen Erzählungen entwickelt. Da ein vorantreibender alternierender Grundrhythmus entsteht, ist der Begriff „Groove“ von Klaus Müller-Wille noch passender (Podcast vom 6.10.2023: https://www.srf.ch/audio/kontext/kultur-talk-der-norwegische-schriftsteller-jon-fosse-erhaelt-den-nobelpreis?id=12459879). Solche Intonations- oder Phrasierungsmuster vermitteln sich beim Hör- oder Bühnenerlebnis so intensiv, dass dieser Effekt auch auf die sog. stille Lektüre übergreift. Hat sich die sprachliche Materialität der Texte erst einmal ‚Gehör verschafft‘, erkennen die Lesenden den auf- und abwogenden Rhythmus wahrscheinlich wieder.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jon_Fosse_Nobelpriset_i_litteratur_2023.png
Sich in die Verirrung bringen, um wieder hinauszufinden – ein schlichtes Drama
Betrachtet man Ein Leuchten (Kvitleik. Forteljing 2023) und Tief im schwarzen Wald (I svarte skogen inne. Skodespel 2023) in der Zusammenschau, zeigt sich unmittelbar eine Gattungsverschmelzung, die einen erzählerisch-szenischen Doppeltext zum Resultat hat. Das Drama ruft eingangs ein Samuel Beckett-Bühnenbild auf, das ein absurd-humoristisches Setting vorgibt: Ein mehr oder weniger ausgeleuchteter Wald. Ein Stein, auf dem man sitzen kann. Einbrechende Dämmerung, dann Dunkelheit. Schneetreiben, dichter werdend.
Das Personenverzeichnis legt nahe, dass gar nicht alle Figuren auf einer Bühne im Sinne eines Schauspiels aufzutreten bräuchten. Entweder ist überhaupt nur die Hauptfigur, der „jüngere“ Autofahrer anwesend, der seinen Monolog spricht, oder es kommen vier Stimmen zum Einsatz: die des jüngeren und die des älteren Paares, während die fünfte Figur, der ‚Mann im schwarzen Anzug‘ zumindest über visuelle Zeichen repräsentiert sein müsste, da sie gestisch kommuniziert. Der Anzugmann bewegt sich auf die genannten Figuren zu oder wieder von ihnen weg und leitet abschließend eine Art Totentanz-Szene an. Für die beiden Paare gibt es eine gewisse Abstufung des Präsenzbedarfs, denn die jüngere Frau trägt ein weißes langes Kleid, d.h. eine durchgehende stimmliche Repräsentation dieser Figur wäre insofern nicht möglich, als sie für Licht und Weiße einsteht („kvitleik“ – wörtlich „Weiß-heit“).
Wichtig sind die Gesten des jüngeren Mannes („yngre mann/ yngre mannsrøyst“), der sich mit seinem Auto im Wald festgefahren hat und während des Einakters im Kreis herumirrt, -denkt und -spricht. Auch die den inneren Monolog begleitete Mimik und die Tonalität des Sprechens bedeuten für die Schauspielenden Freiheit und Herausforderung zugleich. Der orientierungslose Autofahrer im Wald zeigt nämlich nach rechts und links bzw. in drei verschiedene Richtungen, dreht sich um sich selbst, um sein bewusst herbeigeführtes Verirren und sein Absuchen des Waldes zu veranschaulichen. Wie konkret er im Kreis läuft, zeigt sich am ‚Zeitmesser-Requisit‘ des großen Steins, den er zwei Mal passiert. Die Eltern des jüngeren Mannes könnten dagegen in einer rein akustischen Domäne verbleiben, hier wird die bloße Stimme als präferierte Alternative angeführt (z.B. „Stimme der älteren Frau/ ältere Frau“; „eldre kvinnerøyst/ eldre kvinne“). Die Sichtverhältnisse im Wald erschweren eine Begegnung, wie in den Repliken angegeben wird, und die Stimmen der besorgt suchenden Eltern sind mal lauter, mal leiser.
Dass wohl ein Mann im schwarzen Anzug auf der Bühne repräsentiert sein sollte, heißt aber noch nicht, dass die Todesthematik alle anderen Facetten dominiert. Auch würde zu kurz greifen, die Weißgekleidete erst als rettende Engelsgestalt und dann als Alliierte des Anzugmannes zu verstehen. Ohnehin wird im Stück erwähnt, dass es sich bei der Wendung I svarte skogen inne um eine Redensart handelt; selbst ‚in der tiefsten Finsternis‘ bleibt sich das Stück als Text bewusst. Die Figuren sind stilisiert, beispielsweise in ihrer überdeutlichen Komplementarität und in ihren markanten Gemeinsamkeiten: Sowohl der Anzugmann als auch die Weißgekleidete treten barfuß auf, sie bewegen sich außerdem gegenläufig (vgl. S. 31). Es sind Gestalt gewordene ikonographische Einheiten oder papierene Personifikationen, die jegliche Tragik abfedern, das Absurde jedoch umso mehr herausstellen.
Der jüngere Mann hat sich selbst in die verfahrene Lage gebracht; seine Hakenschläge beim Befahren der Waldwege, bis sich das Auto festfährt, lassen sich als Versuch verstehen, eine Neuorientierung herbeizuzwingen. Seine Fahrt ist nicht einer Todessehnsucht geschuldet. Im inneren Monolog werden mögliche Hintergründe des eigenen Verhaltens, Risiken oder auch zuversichtlichere Szenarien durchgeprobt, wobei das Sprechen selbst ermutigt: „rickel, rickel, ruckel/ recht kurze Pause/ rickel, rackel, ruckel/ kurz Pause, fast begeistert/ aber vielleicht/ ja wenn ich einfach weitergehe/ ja weiter in den Wald hinein/ dann muss ich doch jemanden treffen/“ („rikk/ rikk/ rikka/ ganske kort pause/ rikk, rakk, rikka/ kort pause, litt entusiastisk/ men kanskje/ ja om ej berre går vidare/ ja vidare in i skogen/ så må ej jo koma til nokon/“ S. 14ꟷ15). Die erste andere Stimme, die nach 20 Seiten zu hören ist, ist die der Mutter, die dem Vater Vorhaltungen macht, der sich nur widerwillig am Gespräch beteiligt. Die Eltern schwanken in ihrer Einschätzung, wie ihr Sohn bisher durchs Leben gekommen ist: War er nicht schon immer etwas sonderbar? Oder war er nicht eigentlich doch ganz lebensfroh und vor allem ein souveräner Autofahrer? Es bleibt unklar, ob der Protagonist die Eltern anfangs überhaupt hören oder sehen kann, denn er reagiert erst nur auf die jüngere Frau, die sich vor ihn hinstellt, die er aber nicht zu kennen scheint. Auf seine Frage nach ihrem Namen, bleibt diese ihm die Antwort schuldig, sie kann ihm auch den Weg nicht zeigen (vgl. S. 32ꟷ34), schickt ihn aber nach Hause und mahnt: „Du kannst gerade nicht klar denken“ („No tenkjer du ikkje klårt.“ S. 37). Die Stimmen der besorgten Eltern treten hinzu, so dass sich die Dialoge der beiden Paare überkreuzen. Die Hauptfigur schlägt der Weißgekleideten vor, sich im Auto aufzuwärmen und die Scheinwerfer anzuschalten, ein haltloser Versuch, da niemand den Rückweg kennt. In beiden Paaren haben die weiblichen Figuren die Führung übernommen, ein Charakteristikum in vielen genderspezifischen Konstellationen bei Fosse, um nicht zu sagen, eine typische Arbeitsteilung der Geschlechter.
Die jüngere Frau entdeckt nun das ältere Paar im Wald und macht den jüngeren Mann auf die beiden Alten aufmerksam, obwohl er sie zu ignorieren versucht. Der skizzierte psychologische Konflikt, die Scham des Sohns über sein Scheitern und das gestörte Verhältnis der Mutter zum Sohn, steht mit der selbstreflexiven Monologführung im Widerspruch, was die Kohärenz des Dramas verringert, wie ohnehin jede Aufführung als ‚Figuren-Schauspiel‘ in Anbetracht von Fosses Gesamtwerk beinahe anachronistisch erscheint. Kurz vor der davonschwebenden Schlussszene weist der jüngere Mann die Weißgekleidete auf den inzwischen zugeschneiten Stein hin, damit sie kurz ausruhen kann. Vorher wurden die beiden unterschiedlichen ‚Erlösungslandschaften‘ des Mannes und der weißen Frau im Vergleich vorgestellt: Für ihn ist es die unendliche kompakte Weiße einer geschlossenen Schneedecke, für die weiße Frau dagegen ein leuchtender Sonnenaufgang über dem Meer oder ein abendlicher Sonnenuntergang – beides intertextuell anspielungsreiche Szenographien und allegorisch übercodiert (vgl. S. 64).
Wenn überhaupt, verursachen Scham und Verdrängung die große Krise der Hauptfigur, nicht aber das Selbstexperiment der arrangierten Verirrung. „Einfach hier stehen/ ja an diesem Punkt/ ja an diesem Punkt stehen und daran denken/ unterbricht sich, recht kurze Pause/ ja daran, dass es ja auch ein Ausgangspunkt ist/ recht kurze Pause/ Punkt Ausgangspunkt“ („Berre stå her/ ja på dette punktet/ ganske kort pause/ punkt punkt punkt/ ja stå her på dette punktet og tenkja på/ bryt seg av, ganske kort pause/ ja på att dette er jo òg eit utgangspunkt/ ganske kort pause/ punkt utgangspunkt/“ S. 21) Vielleicht folgt diese Figur eher den anderen, als dass sie den Neuanfang auf einem weißen Blatt, from scratch, oder aber das Verlassen der Welt herbeisehnen würde. Vielleicht kommt es aber auch vor allem auf die Retrospektive an, wie die elterliche Profilierung des aus der Bahn geratenen Sohnes veranschaulicht. Klaffen nicht oft die (auto)biographischen Erzählungen und die Geschichten der anderen über Erfolge und Scheitern eines Mitmenschen, den sie zu kennen meinen, weit auseinander? „[E]r fuhr immer so gerne Auto“ („han likte så godt å køyra bil“, S. 80), gibt der Vater zu bedenken.
Im dichten Blocksatz eingekreist
Liest man nach der Lektüre des Dramas I svarte skogen inne das Prosa-Pendant Kvitleik,liegt nahe, dass der Autofahrer seiner Verirrung vielleicht nicht gewachsen war. Im Prosatext werden die sowohl kreisenden als auch abschweifenden Gedanken des Sohnes vertieft, beispielsweise über die spärliche Bevölkerung der entvölkerten Gegend, wer hier wohl einen Führerschein habe oder über die Renovierung eines verfallenen Hauses. Markant ist das positive Verständnis der herbeigeführten Irrfahrt im ersten Satz der Erzählung: „Ich habe mich verfahren. Das tut gut. Die Bewegung tat gut.“ („Eg køyrde av garde. Det gjorde godt. Rørsla gjorde godt.“ S. 7).
Die Figurengalerien der Erzählung Kvitleik und des Dramas I svarte skogen inne weichen voneinander ab. In der Langerzählung tritt außer der Mutter des Protagonisten keine weibliche Figur auf, obwohl die weiß leuchtende Gestalt, hier als ‚weißer Umriß‘ bestimmt, vom Protagonisten zunächst für eine Frau gehalten wird, dann jedoch weniger menschlich-konkret erscheint als die weißgekleidete Frau im Stück.
Die Fülle an Details verstärkt natürlich die Option einer Psychologisierung des einsamen männlichen Charakters („mutterseelenallein“/ „mutters aleine“, S. 53), der sich vor allem über sein Sohnsein definieren musste. Anders als im Drama bleibt der festgefahrene Autofahrer eine ganze Weile im beheizten Wagen sitzen, bevor er meint, aufbrechen und Hilfe holen zu müssen. Dass er Helfende ausgerechnet im Waldesdunkel sucht und dass er sich überhaupt so unüberlegt auf diese Irrfahrt eingelassen hat, verwundert ihn mehrfach. Nach dem ersten Auftritt der weißen Erscheinung in der Waldfinsternis, „ich bin, der ich bin“ („eg er den eg er“ S. 40), scheint es noch die Chance zu geben, einen Ausweg zu ersinnen. Die fragile Balance gerät erst nach dem Erscheinen der Eltern, insbesondere der fürsorglich-vorwurfsvollen Mutter ins Wanken. Am Ende scheint die Familie gemeinsam ins ‚Dort‘, auf die ‚andere Seite‘ aufzubrechen. Statt um Scham und Verdrängung (wie im Drama) geht der psychologische Konflikt in Kvitleik um das initiativlose und schweigende Verhalten von sowohl Sohn als auch Vater, das im Umgang mit der Mutter zu einem lähmenden Muster geworden ist. Wie im Drama hatte die Mutter darauf gesetzt, dass auch der Vater das Gespräch mit dem Sohn suchen würde, um die elterlichen Ermahnungen vorzubringen. Ebenso war sie fälschlicherweise davon ausgegangen, dass es ein väterliches Wissen um den richtigen Weg (nicht nur aus dem Wald) gebe.
Natürlich ist auch der schwarze Anzug-Mann wieder mit von der Partie. Die schematische Anlage des Weiß-Schwarz-Antagonismus führt zu einer Verfremdung durch den Verbund von Prosa und Drama; Kvitleik bietet sich mithin als umgeschriebenes und im Detail ausgestaltetes Drama in epischer Form dar. Entsprechend sind einige der Bühnenbild- und Regieanweisungen in die Erzählung integriert worden: „Jau, ein großer, runder Stein mitten im Wald, ein Stein wie gemacht dafür sich draufzusetzen“ („Jau ein stor og rund stein der midt inne i skogen, ein stein som laga for å sitja på“ S. 21).
Abweichend vom Stück werden Naturelemente eingesetzt, interessanterweise theatral und kulissenhaft, das wechselnde Mondlicht und der Sternenhimmel, wobei deren jeweilige Beleuchtungsintensität mit der Deutlichkeit und Lautstärke der elterlichen Stimmen bzw. mit der Entfernung/Nähe dieser beiden Figuren korrespondiert. Die dichte, absatzlosen Blocksatz-Darbietung dieser Erzählung, die mit „Weiße“ (vgl. S. 72) endet, während das Drama die Farbe Schwarz als Schlusspunkt setzt, signalisiert zugleich durchgehend eine modernistisch-sprachbewusste Eigengesetzlichkeit.
An mehreren Stellen bricht Komik hervor, mal übermütig, mal eher makaber. Der Stein, der wiederholt als Ruhesitz angesteuert wird, ist etwa als Requisit – und nicht als Findling – tatsächlich dafür gemacht, als Sitzplatz verwendet zu werden (s.o.). Oder die Verfremdung des spirituellen Leuchteffekts wird grell übersteuert, indem der verirrte Mann auf die „ich bin, der ich bin“-Formel in seinem Monolog erwidert: „und ich denke, dass ich diese Antwort schon einmal gehört habe, aber ich kann mich nicht erinnern, wo das war, vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen“ („og eg tenkjer at det svaret har eg høyrt før, men eg kan ikkje hugse kvar eg høyrde det, eller kanske las eg det einkvan staden“ S. 40). Auf die weiße Gestalt, die im letzten Abschnitt beim Auftauchen des Anzugmannes wieder aktiv wird, reagiert der Protagonist selbst fast mit einem überwältigten Lachen:
„Ich verstehe es nicht. Es übersteigt meinen Verstand, wie man sagt. Redensarten, eine Redensart. Aber überhaupt in dieser Lage von Verstand zu sprechen, das wirkt nicht sinnvoll, nein jetzt muss ich aber wirklich gleich lachen.“
„Eg skjønar ikkje dette. Det overgår min forstand, som det heiter. Talemåte, ein talemåte. Men å snakke med forstand i det heile, ja slik eg no har det, ja det kjennest ikkje rimeleg, nei no er det rett før eg byrjar le, ja det òg.“ S. 62-63)
Sogar das Todestanzmotiv wird relativiert durch eine Geste, die angesichts des übermäßigen gemeinsamen Einflusses der Eltern gleichermaßen sowohl an Brechts V-Effekt als auch an das Victory-Zeichen erinnert: „[M]eine Mutter und mein Vater, jetzt stehen sie dort Hand in Hand. Ihre herabhängenden Arme bilden ein V zwischen ihnen.“ („mor mi og far min, no står dei der og held einannan i handa. Armane deira heng ned som ein v imellom dei.“ S. 65). Dennoch schwebt die Familie, nun in ein Grau gehüllt, gemeinsam auf die ‚andere Seite‘, wobei der Styx in Richtung auf ein weißes Licht hin passiert wird (vgl. S. 71).
Die Rezensentin Sigrid Löffler hat auf die deutsche Übersetzung von Kvitleik, den Band Ein Leuchten (2023) beinahe empört reagiert, so als habe sich der Nobelpreisträger einen Flop erlaubt. Im Artikel „Der ganze Fosse auf 80 Seiten“ (Süddeutsche Zeitung 11.12.2023) scheint Löffler davon auszugehen, dass es sich um ungeschickt formulierte religiöse Literatur handle, die aufgrund von „Ausdrucksdürftigkeit und Variationsarmut“ in die Banalität umzukippen drohe. Der Umgang mit Fosses Repertoire scheint jedoch Löffler wenig geläufig, wodurch ihr die intratextuelle Komik und die Beckett-Offerten entgehen. Darauf lässt zumindest ihr grimmiger Kommentar schließen: „Der erste Verdacht, hier würden die Nahtod-Bücher der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross satirisch verulkt, erübrigt sich, denn Jon Fosse hat keinen Humor.“ (Löffler, wie oben).
Vor diesem Hintergrund halte ich auch die Markierung „Ein kleines Meisterwerk über den Tod“ („et lite mesterverk om døden“) auf dem Einband von Kvitleik, für die sich der norwegische Verlag Samlaget entschieden hat, für etwas missverständlich. Eine bewährte Rezeptionstradition scheint beschworen, nicht zuletzt das Wiederaufleben der „seelischen Landschaften“ um 1900 und damit auch einiger Schablonen der deutschsprachigen Fosse-Rezeption (vgl. Suzanne Bordemann, 2013). Was dereinst als ‚Todessehnsucht‘ und ‚Weltschmerz‘ wertgeschätzt wurde, sollte heutige Perspektiven nicht vereinseitigen und so auch nicht länger dazu beitragen, dass Lesende von der Melancholie in Fosses Werk gänzlich überwältigt werden.
Spiel wirklich mit mir oder: Aufbruch in die akustische Werkstatt
Das Miniatur-Stück für die Stimme einer erwachsenen Person und eines Kindes „Leike leiken. Lydspel for to røyster“ (2023, 13 Seiten) ist von einem Hörspiel kaum mehr zu unterscheiden. Selbst wenn das Stück mit verteilten Rollen vorgelesen wird, kann sich sein Charme entfalten. Die Regieanweisung sieht nämlich eine leere Bühne vor, und das Spiel setzt mit dem Einschalten der Beleuchtung und einer Pause ein. Fast könnte man die Einfachheit des Stücks als Aufforderung verstehen, sich an einer Improvisation zu versuchen. Der Einakter kann niedrigschwellig und recht humoristisch gespielt werden oder mit einer starken Betonung der reflektierenden oder meta-theatralen Passagen.
Vorausgesetzt ꟷ und für die noch ausstehende deutsche Übersetzung äußerst schwierig ꟷ ist die Unterscheidung von „leik“ als freiem, auch schauspielerndem Spiel und „spel“ als regelgeleiteten, auf antizipierenden Vereinbarungen basierendem Spiel, wie bei Gesellschaftsspielen oder Sportwettbewerben. Der Titel selbst ruft dieses Spannungsverhältnis auf. Das Kind und die erwachsene Begleitperson (letztere in einigen Beschreibungen des Stücks auch als „han“ bestimmt, vgl. https://tv24.se/p/jon-fosse-ord-for-ord-sasong-1-avsnitt-42-rragwe) haben erwartungsgemäß unterschiedliche Erwartungen an das Spielen. Der erwachsene Mensch scheint einschätzen zu wollen, was zu erwarten ist: Welche Fertigkeiten sind gefragt? Wie lange wird es dauern? Was scheint lockend daran? Das Kind in der ‚akustischen Szene‘ besteht auf einem freien Spiel mit offenem Ausgang, bei dem es Anweisungen jeweils für bestimmte Handlungsabschnitte geben möchte. Schon der erste Auftrag an die erwachsene Person, sich in die Mitte der Bühne (bzw. eines imaginären Platzes, der ‚auf dem Heimweg‘ passiert wird) zu stellen, bereitet der Begleitung Schwierigkeiten. Das Einnehmen einer bestimmten Pose muss ebenfalls durch das Kind nachkorrigiert werden, und die Aufgabe, auf der Stelle zu hüpfen, wird schlechtweg auf eine Weise verweigert, die dem Kind klar macht, dass es den Schwierigkeitsgrad senken muss, damit das Spiel(en) überhaupt läuft. Die Spielfreude ist auf beiden Seiten bereits etwas getrübt, aber das Kind beruhigt, das Hüpfen sähe gar nicht verrückt („toske“, S. 22) aus, da es doch innerhalb eines Spiels geschähe; es schlägt dann kompromissbereit vor, dass seine erwachsene Begleitung anstelle der Hüpfbewegung etwas sagen könnte. Dabei wird die Replik „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“ („Eg veit ikkje kva eg skal seia“, S. 26) großzügig gelobt, und das Kind ermuntert zum Weitersprechen, bis der erwachsene Mensch nun gar nicht mehr weiterweiß.
STIMME DES ERWACHSENEN/ Du hast ein Spiel erfunden/ Und jetzt spielen wir wohl dieses Spiel/ STIMME DES KINDES/ Ja/ ja jetzt spielen wir das Spiel/ ganz genau/ STIMME DES ERWACHSENEN/ Und mein Kopf ist völlig leer/ Mir fällt nicht ein, was ich sagen könnte/ STIMME DES KINDES/ Ja/ ja so läuft das Spiel/ Kurze Pause/ Und dann hüpfst du
VAKSENRØYST/ Du har funne på ein leik/ Og no leiker vi visstnok leiken/ BARNERØYST/ Ja/ Ja no leiker vi leiken/ Heilt rett/ VAKSENRØYST/ Og nu er heilt tomt i hovudet mitt/ Og kjem ikkje på meir å seia/ BARNERØYST/ Ja/ Ja slik er leiken/ Kort pause/ Og så hopper du/
Beim zweiten Versuch, zum Hüpfen zu animieren, beschwichtigt das Kind, dass doch niemand die Sprungversuche sehen könnte, womit der meta-theatrale Bezug auf das freie und zugleich geregelte Spiel der Theaterinszenierung explizit hervortritt. Das Spiel im Spiel verwandelt sich zu einem kleinen Stimmen-Spiel über das Spielen.
Obwohl das Kind kritisiert, dass seine erwachsene Begleitung das Spiel eigentlich nicht verstanden habe und die ‚freie Schöpferkraft‘ des Kindes nicht akzeptiere, begnügt es sich; immerhin wurde doch eine Variante des anfangs vom Kind ersehnten Spiels verwirklicht. Diejenigen, die Fosses Dramatik eigenmächtig übertragen, umformen oder medial und multimodal in Bewegung versetzen, dürfen sich also bestärkt sehen.
Bei der Reaktualisierung von Fosses Werken werden zukünftig aller Voraussicht nach szenische Lesungen am Theater sowie Hörspiele, Hörbücher und vielfältige intermediale Kombinationsformate im Zeichen zunehmender Medienkonvergenz erfolgreich sein. Dies dürfte sich auf neue Inszenierungen und Adaptionen ‚frei nach Fosse‘ auswirken und interessante Wechselwirkungen entfalten. Dabei wäre durchaus möglich, dass der Autor selbst die Effekte von Gattungskombinationen und unterschiedliche intermedialen Alternativen bereits in der Konzeptionsphase bedenkt.
Für anregende Gespräche über u.a. Ein Leuchten und I svarte skogen inne danke ich den Teilnehmenden des Podiumsgesprächs „Die drei Genres des Jon Fosse“ an der Universität Wien/ Abteilung Skandinavistik am 24. April 2024 sehr herzlich: Suzanne Bordemann, Uwe Englert, Andreas Karlaganis, Dörte Lyssewksi und Arild Vange.
- Jon Fosse: Kvitleik. Forteljing. Oslo: Samlaget, 2023.
- Jon Fosse: I svarte skogen inne. Skodespel. Oslo: Samlaget, 2023.
- Jon Fosse. „Leike leiken. Lydspel för to røyster“, in: Syn og Segn, Nr. 4, 2023, S. 19-32.
(Antje Wischmann, Universität Wien)