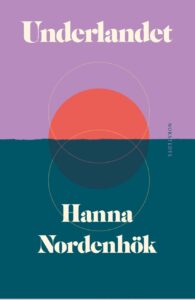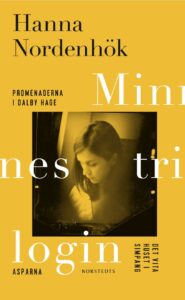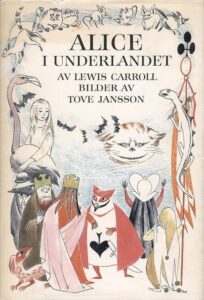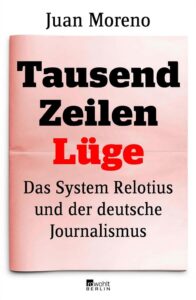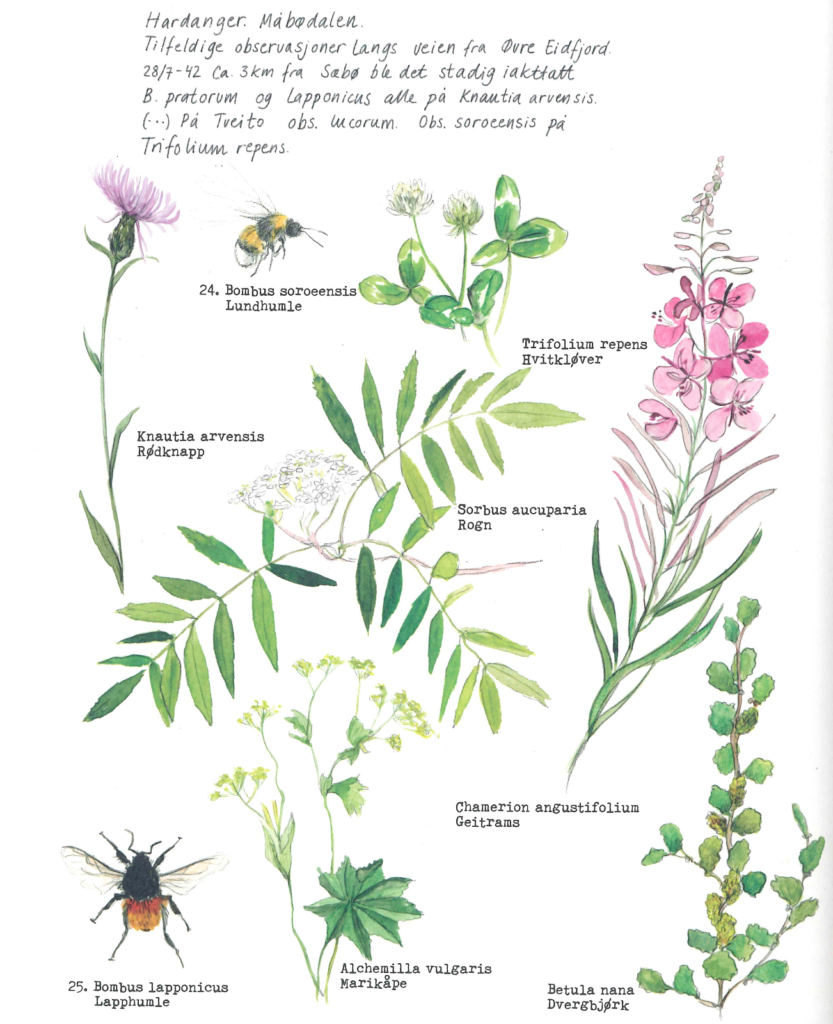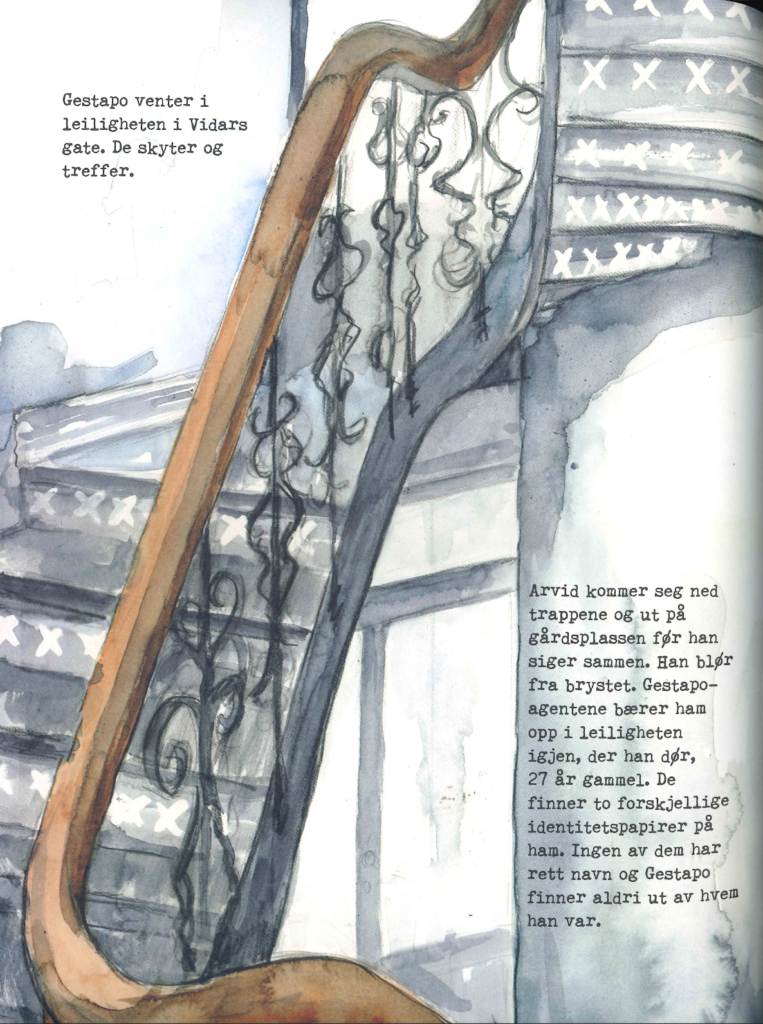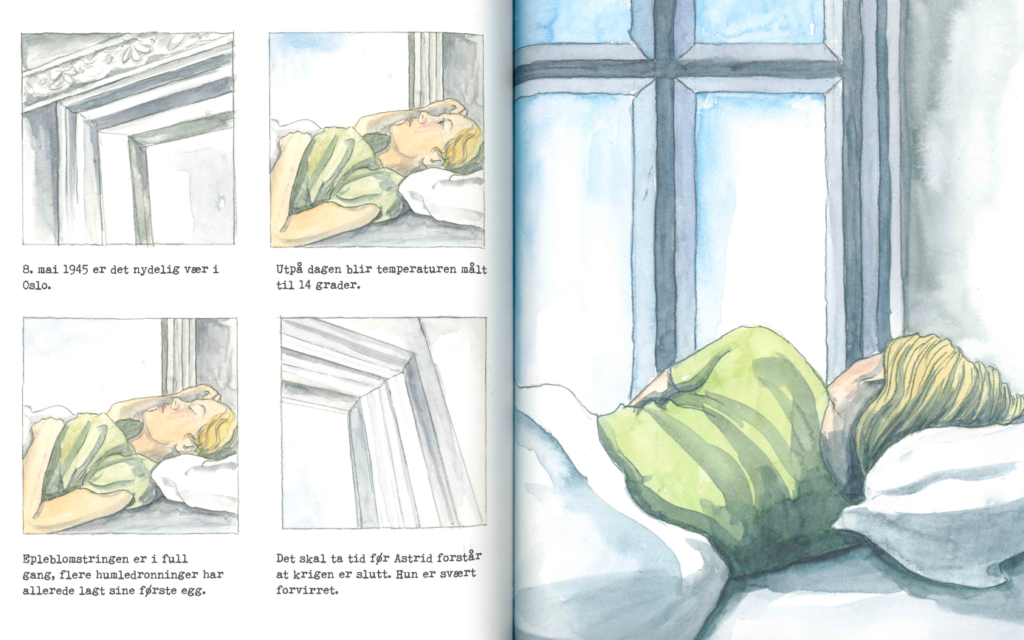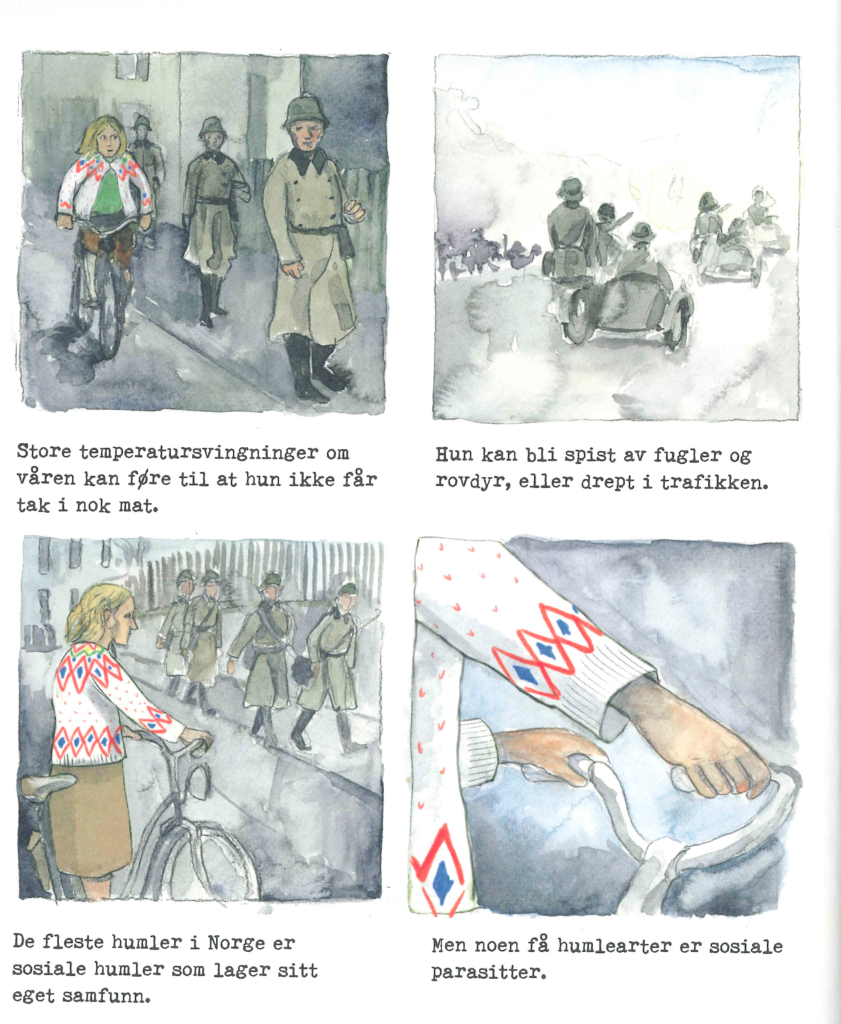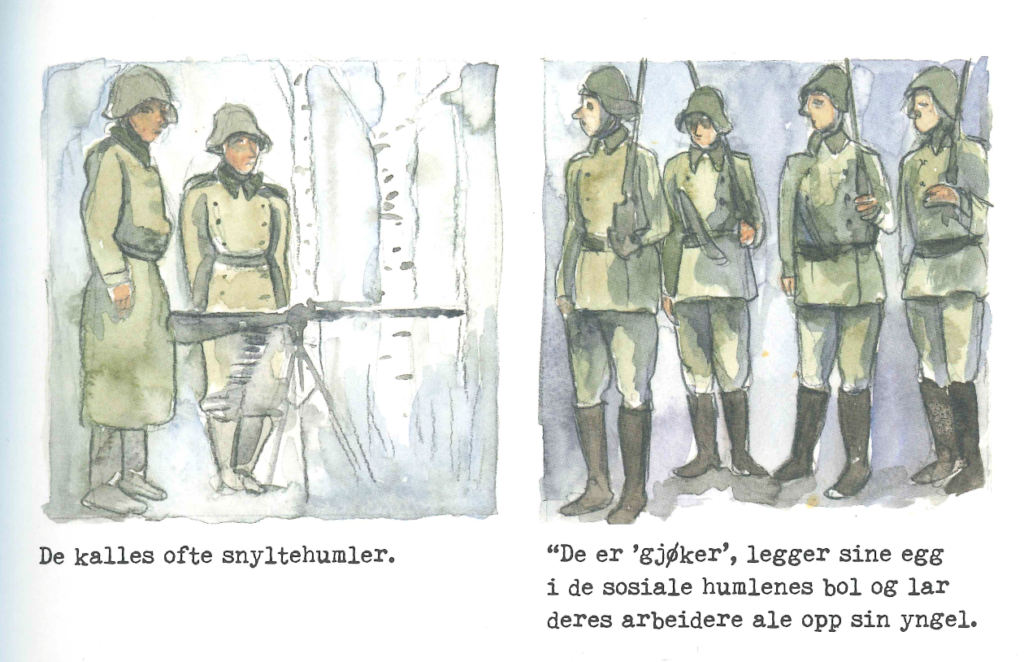Wer auch immer prägnante Trends in der skandinavischen Literatur der 2010er Jahre benennen möchte, kann auf die Genrebezeichnung Autofiktion wohl kaum verzichten. Mit Karl Ove Knausgård, Vigdis Hjorth, Lars Norén, Karolina Ramqvist und vielen anderen namhaften Autor*innen hat dieses schwer bestimmbare Genre sowohl für beträchtliche Verkaufszahlen als auch für intensive Literaturdebatten über Authentizität und Deutungshoheit gesorgt.
Der 2023 erschienene Roman Underlandet [Das Wunderland] von Hanna Nordenhök kann als ein Kommentar zur gegenwärtigen Besessenheit vom vermeintlich Authentischen gelesen werden (siehe dazu eine Rezension von Ulrika Milles in Expressen). In diesem Roman bedient sich Nordenhök der Autofiktion, aber interessanterweise nicht als Technik der Selbstdarstellung, sondern als Motiv, indem sie die vielen Romanfiguren zu autofiktiven Versionen ihrer Selbst macht. Als eine Art Zeitdiagnose wird das Thema der Authentizität in Underlandet vor allem anhand seiner vermeintlichen Gegensätze – Betrug und Selbstbetrug, Täuschung, Schein, Lüge, Unwahrheit – in drei längeren Erzählungen und fünf kürzeren Episoden verarbeitet. Von schwedischen Literaturkritiker*innen ist der Roman überwiegend mit Begeisterung aufgenommen worden. So bescheinigt der Literaturkritiker Joel Kjellgren Hanna Nordenhök meisterliche Darstellungen von „det ögonblick då livslögnen krackelerar“ [dem Augenblick, in dem die Lebenslüge zerbricht] (Rezension in Aftonbladet).
Underlandet ist der fünfte Roman der Schriftstellerin und Übersetzerin Hanna Nordenhök (geb. 1977). Wie ihr Vater Jens Nordenhök übersetzt sie Literatur aus dem Spanischen, u.a. von Fernanda Melchor. Nach ihrem lyrischen Debüt mit Hiatus im Jahr 2007 hat sie einen weiteren Gedichtband und fünf Romane veröffentlicht. Ihre ersten drei Romane Promenaderna i Dalby Hage (2011) [Die Spaziergänge im Hain von Dalby], Det vita huset i Simpang (2013) [Das weiße Haus in Simpang] und Asparna (2017) [Die Espen] sind nachträglich zu einer ‚Gedächtnistrilogie‘ zusammengeführt worden, da sie alle auf historischen Dokumenten und auf Nordenhöks eigener Familiengeschichte basieren. Wie die Literaturwissenschaftlerin Johanna Lindbo in Bezug auf Det vita huset i Simpang in einem Artikel bemerkt hat, schreibt Nordenhök eine detailreiche und sinnliche Prosa, die den dargestellten Räumlichkeiten, wie etwa den Interieurs, der Wohngegend, institutionellen Gebäuden, städtischen Milieus oder auch den Landschaften viel Aufmerksamkeit schenkt.
Hanna Nordenhök gehört zu einer wachsenden Gruppe promovierter Schriftsteller*innen in Schweden. 2018 hat sie ihre Dissertation über drei zeitgenössische Lyrikerinnen und deren Schreibprozesse an der Universität Göteborg abgeschlossen. Darüber hinaus schreibt Nordenhök Literaturkritik, vor allem bei der Boulevardzeitung Expressen. Für den Roman Caesaria über ein verwaistes Mädchen im 19. Jahrhundert, das von dem Arzt, der es durch einen Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat, auf einem schönen Gutshof irgendwo in Schweden gefangen gehalten wird, wurde Nordenhök 2021 der Romanpreis des Schwedischen Rundfunks verliehen.
Die vielseitige literarische Tätigkeit von Hanna Nordenhök spiegelt sich in ihrem gekonnten Umgang mit der Sprache und dem Erzählstoff in Underlandet wider. An dem Roman fällt unmittelbar der komplexe Aufbau auf. Die drei längeren Erzählungen „Underlandet“ [Das Wunderland], „Hyperion Hotel“ und „Huset på slätten“ [Das Haus in der Ebene] werden in drei bis fünf Abschnitten abwechselnd erzählt und durch fünf kürzere Episoden mit dem Titel „(fallbeskrivning)“ [Fallbeschreibung] ergänzt. Die einzelnen Geschichten sind durch das Hauptthema Betrug und (Un-)Wahrheit auf einer Ideenebene miteinander verbunden, haben jedoch sehr unterschiedliche Schauplätze und sind aus der Sicht verschiedener Figuren dargestellt. Die Gattungsbezeichnung ‚Roman‘ weist in diesem Fall also nicht auf eine groß angelegte, kohärente Erzählung hin und steht interessanterweise nicht auf dem Buchumschlag, sondern nur auf dem inneren Titelblatt. Es handelt sich hier eher um eine ‚kaleidoskopische Technik‘ des Erzählens, wie Ulrika Milles in Expressen bemerkt, in der zahlreiche Formen des Selbst- und Fremdbetrugs durch die verschiedenen Geschichten und Episoden zu einem facettenreichen Ganzen zusammengesetzt werden.
Diese Komplexität findet auch in der Themenvielfalt des Buches ihren Ausdruck. In der ersten, titelgebenden Geschichte „Underlandet“ ist die Hauptfigur eine obdachlose Frau, die wahrscheinlich Josie heißt, aber sich in jedem Kapitel einen neuen Namen gibt. Die Geschichte spielt in einem Teil der USA, dessen Wälder und Meeresstrände Josie Verstecke bieten und die an Kalifornien denken lassen. Um an etwas Essen und Geld zu kommen, gibt sich die kleine Frau für ein Kind oder eine Jugendliche aus und wird von besorgten Familienmüttern und jungen Männern zu sich nach Hause eingeladen. Das Wunderland aus dem Titel lässt die Geschichte, in der die obdachlose Josie in einer Parallelwelt von Ort zu Ort irrt, wie ein groteskes Zerrbild des Kinderklassikers Alice i Underlandet [Alice’s Adventures in Wonderland] von Lewis Carroll erscheinen. Der Titel weckt auch die Assoziation zu den USA als ‚land of dreams‘, wo das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit die Verwirklichung vom ‚American dream‘ ermöglichte. In Nordenhöks Roman ist das alles längst vorbei, was dem ‚Wunder‘ im Titel einen ironischen Klang verleiht. Die anderen Geschichten im Roman spielen zwar alle in Europa, aber die postindustriellen, von globaler Finanzwirtschaft und weltweiten Notlagen geprägten Schauplätze dieser Geschichten unterscheiden sich im Roman nicht nennenswert von den amerikanischen.
In der zweiten längeren Geschichte, „Hyperion Hotel“, entdeckt der Journalist Vega aus Barcelona, dass sein erfolgreicher Kollege Marius seine Reportagen über geflüchtete Kinder in Athen gefälscht hat. Während Marius’ Karriere mit diesem Skandal abrupt endet, verfasst Vega über den Fall Marius einen Bestseller und erntet journalistischen Ruhm. Nach einer Lesung von Vega stellt ein Zuhörer die kritische Frage, wo die Grenze zwischen Wahrheit und Unwahrheit verlaufe, ob nicht alle Berichte und Erzählungen in irgendeiner Weise Fälschungen seien, da sie sich der Fiktionalisierung bedienten. Vega ist von dieser Frage sehr peinlich berührt, und danach lässt ihn sein homoerotisch angehauchtes Erinnerungsbild von Marius im Hyperion Hotel in Athen kurz nach seiner Entlarvung nicht mehr los. Der Stoff von „Hyperion Hotel“ wie auch von „Underlandet“ basiert auf wahren Begebenheiten. Die Geschichte über die zwei spanischen Journalisten, die in ein Katz-und-Maus-Spiel in Athen verstrickt sind, weisen Parallelen zum publizistischen Skandal um den Spiegel-Journalisten Claas Relotius auf. Im Herbst 2018 hatte Relotius’ Kollege Juan Moreno beweisen können, dass Relotius’ preisgekrönte Reportagen in beträchtlichen Teilen gefälscht oder frei erfunden waren. 2019 hat Moreno das Buch Tausend Zeilen Lüge über den Fall veröffentlicht und wurde kurz darauf selbst beschuldigt, Falschdarstellungen darin eingebaut zu haben. Durch „Hyperion Hotel“ rückt die Manipulierbarkeit der Sprache in den Vordergrund des Romans, aber Fragen über Wahrheit und Unwahrheit werden in allen Geschichten verhandelt, ob in der Politik, in der PR, in fiktionalen Texten, in sozialen Medien oder in der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Die letzte, ausführlichere Geschichte, „Huset på slätten“, spielt im südschwedischen Schonen, wo eine wohlhabende Ehefrau ein Verbrechen ihres Mannes, nämlich den Besitz von kinderpornographischem Bildmaterial, deckt, um ihr bequemes Leben im luxuriösen Eigenheim nicht aufgeben zu müssen. Gleichzeitig postet sie fleißig Bilder in den sozialen Medien von ihrer teuren Küche, ihren Designermöbeln aus Holz und ihren Zwillingstöchtern, um die sich eine Kinderfrau kümmert. Die Geschichten „Underlandet“ und die Fallbeschreibungen sind linear erzählt, während „Hyperion Hotel“ und „Huset på slätten“ als Rückblicke auf vergangene Begebenheiten aufgebaut sind, was verschiedene Formen der Spannungserzeugung ermöglicht. In den zuerst genannten Fällen erleben die Leser*innen die zum Teil dramatischen Ereignisse direkt mit, während die Hauptfiguren der anderen beiden Geschichten nur schrittweise verraten, was in der Vergangenheit passiert ist.
In den Fallbeschreibungen, d.h. zwischen den Abschnitten der drei Haupterzählungen, werden weitere Formen des Betruges und der Täuschung ausgeleuchtet: Ein Finanzkrimineller wird wegen Veruntreuung von Wohltätigkeitsgeldern in seiner wunderschönen Stockholmer Wohnung verhaftet; ein MMA-Kampfsportler aus Südschweden dopt sich, um seine Kämpfe zu gewinnen; eine Schulleiterin aus Paris wird mit einer verwahrlosten Schülerin in der heruntergekommenen französischen Kleinstadt Béthune konfrontiert, die ständig neue Verletzungen und Krankheiten erfindet; ein rechtsextremer Politiker aus Bayern trifft sich mit einer erfolgreichen PR-Beraterin in Berlin, um sein öffentliches Image salonfähig zu machen; und in der letzten Fallbeschreibung wird schließlich der nackte Körper einer toten, wohlhabenden Frau in Portugal mit vielen Spuren von Schönheitsoperationen im Bett aufgefunden.
Die Fallbeschreibungen widmen sich somit einerseits tatsächlichen oder vermuteten Verbrechen, die an die Auflösung von Kriminalfällen und Polizeiakten denken lassen. Zugleich wird das Genre des psychoanalytischen Fallbeispiels aufgerufen, gerade weil dysfunktionale oder nicht vorhandene Familienbeziehungen in fast jeder Erzählung eine entscheidende Rolle übernehmen. Der ‚Fall‘ kann auch als ein tatsächlicher oder drohender sozialer Abstieg gedeutet werden: Nordenhöks Romanfiguren gehören häufig der Unterschicht an oder haben ein solches Milieu hinter sich gelassen, wie zum Beispiel der MMA-Kampfsportler oder die Ehefrau im luxuriösen Haus in der Ebene, aber sie erinnern sich offensichtlich noch gut daran, wie unwägbar und flüchtig sozialer Status und Erfolg sind, denn ihre Handlungen scheinen beinahe ausnahmslos von Abstiegsangst gesteuert zu sein.
Das schwedische Wort ‚under‘ im Titel des Romans bedeutet nicht nur ‚Wunder‘, sondern auch ‚unter‘ – das Wunderland ist auf Schwedisch gleichzeitig ein ‚Unterland‘. Bei einer psychoanalytischen Deutung des Begriffs assoziieren die Lesenden vermutlich Stichworte wie Verdrängung und Unterbewusstes. Eine Interpretation des Begriffs, die auf die soziale Schichtung abhebt, trifft am besten auf die Titelerzählung „Underlandet“ über die obdachlose Josie zu. Obwohl sie selbst eindeutig der amerikanischen ‚Unterstschicht‘ angehört, wird sie zu einer sozialen Grenzgängerin, indem es ihr weitgehend gelingt, eine unscheinbare oder sogar unsichtbare Beobachterin der Menschen in ihrem Umfeld zu bleiben. Erst wenn Josies vorübergehende Mimikry-Angleichung an ihre Mitmenschen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, muss sie jeweils in die nächste Lebensphase aufbrechen und sich eine neue Wohnumgebung suchen.
Durch Josies bloßstellenden Blick auf das sesshafte Bürgertum, dem die Leser*innen des Romans mit großer Wahrscheinlichkeit selbst angehören, entsteht eine geschickt konstruierte Spiegelung der sozialen Ängste und Selbsttäuschungen der Leserschaft. Diesen Spiegeleffekt scheint die Graphik auf dem Buchumschlag modellhaft zu veranschaulichen. Der Kreis und die Linie in der Mitte des Bildes lassen ganz konkret an eine auf- oder untergehende Sonne und eine Wasserlinie denken. Dabei liegt es auch nahe, eine teilweise überblendete und hin- und herrückende Fokussierung zu assoziieren: Selbst der zentrale Fokus, der sich durch die Schnittmenge der drei Kreise ergibt, ist in eine kleinere obere rote und eine größere untere dunkelblaue Fläche aufgeteilt. In Bezug auf den Romaninhalt wäre eine mögliche Interpretation des Buchumschlags auf symbolischer Ebene, dass subjektive Wahrnehmungen nur anteilig zur Deckung kommen können und dass eine objektive Wahrnehmung per se weder erfasst noch sprachlich vermittelt werden könnte. Die ‚Realität‘ und die Zuschreibungen von Wahrheitswerten bleiben relational.
Auch erzähltechnisch bietet der Roman eine eingeschränkte Sicht auf die jeweiligen figurenspezifischen Ereignisse, indem die Erzählperspektive mittels interner Fokalisierung durch eine bestimmte Figur in jeder Geschichte nach innen gerichtet ist. Dieser Wechsel zwischen den verschiedenen internen Figurenperspektiven verstärkt die kaleidoskopische Erzählweise des Romans. Trotz der internen Fokalisierung bleibt das Innenleben der vielen Figuren in der Gesamtschau vage. Statt eines vertieften, psychologischen Porträts wird jeweils die psychologische Konstellation der Figur in einer Momentaufnahme scharf und kontrastreich durchleuchtet. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Gedankengänge und Beweggründe der Figuren ihnen selbst nicht immer klar sind. Der Literaturkritikerin Martina Montelius zufolge besteht die Intelligenz des Romans darin, dass keine eindimensionalen Erklärungen der Ereignisse geliefert werden, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie unerklärlich bleiben (Rezension in Göteborgs-Posten).
Der Erzählstil von Underlandet ist differenziert und detailreich, mit einem feinen sprachlichen Register. Durch den thematischen Fokus des Romans auf Betrug und Unwahrheit kommen die Lesenden nicht umhin, die psychologische Glaubwürdigkeit und die atmosphärischen Effekte auch von einer Metaebene aus zu betrachten. Vielleicht führt dies zu einer Skepsis gegenüber möglichen manipulativen Mitteln oder auch zur verstärkten Aufmerksamkeit auf Stilfiguren wie Vergleiche und Personifikationen, die zur Bildhaftigkeit des Erzählten beitragen, sowie auf Wiederholungen von gewissen Inhalten wie zum Beispiel die wiederkehrenden Erinnerungen von Vega an die Bespitzelung und Enttarnung von Marius in Athen. Die Wiederholungen wirken auf den ersten Blick beinahe didaktisch, aber die mehrfache Wiedergabe bestimmter Ereignisse kann durchaus auch als eine Problematisierung der Zeugenschaft und des Nacherzählens gelesen werden. So gesehen stellt Hanna Nordenhök auch durch den Textaufbau den Wahrheitsgehalt von Medieninhalten und die vermeintliche Authentizität von literarischen Texten in Frage.
Underlandet ist ein ambitioniertes Gesellschaftspanorama, in dem globale Entwicklungen wie Klimawandel, Pandemie und Digitalisierung einen gegebenen und nur in Andeutungen sichtbar gemachten Hintergrund zu den verschiedenen Geschichten bilden. Dadurch entsteht eine facettenreiche Momentaufnahme der Gegenwart. Durch die vielen Bezüge auf aktuelle Debatten und Probleme verortet Hanna Nordenhök ihren Roman mitten im Gegenwartsdiskurs, aber ohne deutlich Stellung zu nehmen. Es bleibt unklar, ob Underlandet vorwiegend als ein politisches oder dokumentarisches Projekt aufzufassen ist. Es wäre aber auch möglich, Underlandet als ein vor allem ästhetisches Projekt zu lesen – das heißt, als gelungene Erzählkunst und Sprachkunst, die von Nordenhöks literarisch vielseitigen Tätigkeiten als Schriftstellerin, Übersetzerin, Kritikerin und Literaturwissenschaftlerin positiv beeinflusst worden sind.
(Hanna Henryson, Stockholms Universitet)