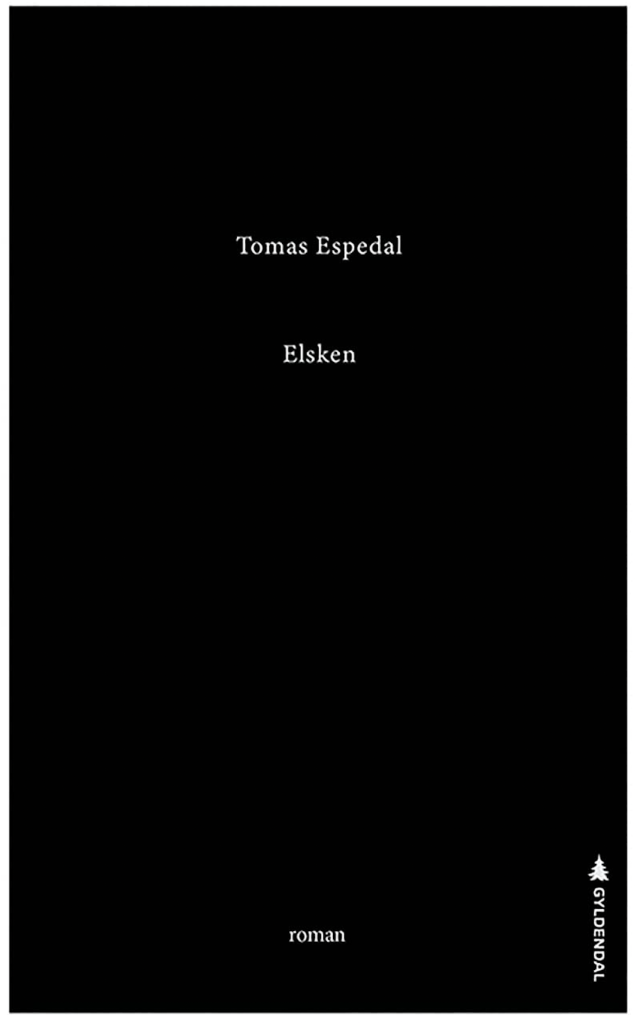Nur wenige andere waren über die Jahre hinweg in einem solchen Maße stilprägend für die skandinavische Autofiktion wie der norwegische Schriftsteller Tomas Espedal. Mit seinem neuesten Roman Elsken, der als Lieben nun auch in deutscher Übersetzung vorliegt, begibt er sich auf die Suche nach dem Tod. Kaum schwerer könnten die Themen wiegen, die der Norweger beleuchtet, kaum länger die Schatten sein, die sie werfen. Doch gerade hier hat es sich Espedal gemütlich gemacht. Vielleicht sogar zu gemütlich.
Ein Schriftsteller am Rande der Wohlstandsverwahrlosung, gefangen zwischen den bitteren Verlusterfahrungen, die er machen musste, und den noch bittereren Schnapsflaschen, die sie ihm vergessen machen, gefolgt von Momenten der Klarheit, in denen die ganze Schönheit des Lebens mit aller Wucht bis in die kleinsten Dinge des Alltags spürbar ist, gefolgt von jungen, attraktiven Frauen, die mit einer fast schon an Gesetzmäßigkeit grenzenden Regelmäßigkeit in das Leben des deutlich älteren Schriftstellers eintreten und es dann wieder verlassen, gefolgt von Passagen eindrucksvoll erzählter Naturprosa. All das dürfte der Leserschaft, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits mit Espedals Büchern in Berührung gekommen ist, nicht unbekannt erscheinen. Immer wieder greift er in seinen Texten auf diese Bausteine zurück, die mittlerweile unverkennbar auf das Erzählprojekt des Norwegers hinweisen. Doch mit jeder Wiederholung dieses Leitmotivs macht sich Espedal angreifbar. Freilich nicht, weil er seinen Leser:innen einen noch tieferen seelisch-moralischen Abgrund präsentiert und so Gesprächsstoff generiert, sondern gerade weil er inhaltlich so berechenbar geworden ist, dass die von ihm erzeugten Momente allmählich ihre Schlagkraft einbüßen. Umso interessanter ist deshalb der Rhythmus, den Espedal in Elsken anzuschlagen versucht. Schon auf den ersten Seiten wird klar, dass der Text überhaupt keinen Hehl daraus macht, aus wessen Feder er stammt:
Wir folgen einem von der Liebe seines Lebens verlassenen Mann durch eine Landschaft, die Verflossene fließt dabei durch die zitternden Blätter der Bäume, fließt durch die Vogelrufe, fließt in dem Wasser des Sees, in dem der Verlassene ein Bad nimmt. Alles hängt zusammen, alles bedingt sich gegenseitig. Es türmen sich existenzielle Fragen auf, Bilder aus vergangenen Tagen verschwimmen miteinander, Sinneseindrücke von damals und jetzt überlagern sich. Die übersteigerte Sensitivität des Mannes kulminiert schließlich in einer »kraftig ereksjon« (10) / »kräftige[n] Erektion« (9), die er zusammengesunken auf einem aufgeheizten und einst durch Gletschermassen rund geformten Felsen bekommt. Auch in Elsken verleiht Espedal der Sexualität seines Ichs einen beinahe transzendenten Charakter. Sie färbt nicht nur die uns präsentierte Aneinanderreihung an aufkommenden Bildern und Gedanken ein, sondern schiebt sich passagenweise wie ein Filter vor den gesamten Text. Diese Momente gehören sicher nicht zu den Stärken des Textes, weil sie wie die Erektion in der Eröffnungsszene wenig subtil und eher aufdringlich anmuten. Besonders deutlich äußert sich das später in der sich anbahnenden Beziehung zu Aka, einer circa 20 Jahre jüngeren Frau, die Espedals Erzähler auf einer Wanderung entlang der Loire und weiter nach Paris begleitet. Findet er »[a]vstandsforelsket« (23) / »[a]uf Abstand verliebt« (27) zunächst vor allem Gefallen an der Stille, die Aka umgibt und in der sie tagsüber während des gemeinsamen Wanderns verschwindet, kann er schon während der ersten Übernachtung der beiden in einem Hotel nicht genau absehen, »hvor mange netter han ville klare å ligge slik ved siden av henne, uten å røre ved henne« (24f) / »wie viele Nächte er es wohl aushalten würde, so neben ihr zu liegen, ohne sie zu berühren« (29). Auch beim gemeinsamen Besuch auf Schloss Versailles dient sie als stille Projektionsfläche, auf der eigene Begehrlichkeiten verhandelt werden. Wie sperrig diese sind, wird spätestens hier offenbar, wenn Aka selbst in den weitläufigen Hallen und Salons des Pariser Schlosses einen passiven Platz als Interieur zugewiesen bekommt: »han betraktet henne nesten som man betrakter et kunstverk […]. [D]et var nærmest som om Aka blev omformet af de rommene hun gikk i, af de ting hun så på; hun tilhørte ikke ham, men disse forglydte speilene, de fargerike stoffer, de kostbare sengene« (25) / »er betrachtete sie fast so, wie man ein Kunstwerk betrachte […]. [E]s war fast so, als würde Aka von den Sälen, durch die sie ging, verwandelt, von den Dingen, die sie betrachtete; sie gehörte nicht zu ihm, sondern zu diesem vergoldeten Spiegel, den bunten Stoffen, den kostbaren Betten« (30). Problematisch ist, dass Espedals Ich in Elsken die Gelegenheit auslässt, diesen bereits ausgiebig bekannten Zug seines Schreibens einer Neubewertung zu unterziehen. Stattdessen erfolgt die Stilisierung der eigenen Potenz mit einem fast beispiellosen Grad an Selbstgefälligkeit, sodass der Text an diesen Stellen abgenutzt und unzeitgemäß daherkommt – vermutlich vermag hier nicht einmal der Spiegelsaal des Schloss Versailles eine Reflexion anzustoßen.
Das ist umso bedauerlicher, zumal sie an anderer Stelle durchaus einsetzen. Als sich der Erzähler in der zweiten Hälfte des Buches mit einer ominösen Vorladung konfrontiert sieht, – ihr Grund bleibt vorerst unbekannt – folgen wir ihm auf einem kaskadenartigen Gedankenstrom. Hier kommt Espedals psychologische Technik zum Tragen und es gelingt ihm auf beeindruckende Weise, innerhalb weniger Seiten eine Topographie der Schuld zu entfalten, deren Raum er bis zu ihren Grenzen auslotet. Schließlich »lengtet [han] etter en forbrytelse. Han kunne ha myrdet. Hvem som helst. Den første og beste han møtte« (71) / »sehnte [er] sich nach einem Verbrechen. Er hätte morden können. Wen auch immer ermorden können. Den Erstbesten, der ihm begegnen würde« (91). Und trotz der Tiefe, die der Text hier aufbaut, kann er an dieser Stelle nur noch erschreckend auf seine altbekannte Oberfläche verweisen, auf das, was schon längst zu Tage gefördert worden ist. Wenn sich dann nämlich in der Anhörung herausstellt, dass der Vorwurf einer Vergewaltigung im Raum steht, dieser aber als vollkommen abwegige und erfundene Spinnerei einer vermeintlich psychisch Kranken abgetan wird, während kurz zuvor die Möglichkeit eines Mordes durchgespielt wird, spätestens dann offenbart sich Espedals fatale Eindimensionalität im Hinblick auf dieses Thema. Von einem Buch, dessen Erscheinungsdatum circa ein Jahr nach dem Aufkommen der #MeToo-Bewegung liegt, muss man mehr erwarten können.
Trotzdem kündigt sich in Elsken schon ab der ersten Zeile etwas fundamental Anderes in Espedals Schreiben an. »Jeg leter etter et sted å dø« (7) /»Ich sucht nach einem Ort zum Sterben.« (5) heißt es im ersten Satz, der zugleich den konzeptuellen Rahmen des gesamten Buches festsetzt. Denn das Ich, von dem Espedal erzählt, hat genug gesehen. Genug, um zufrieden mit sich sein zu können, genug, um all das erlebt zu haben, was es zu erleben gibt, und genug, um zu wissen, dass das, was noch kommen könnte, nichts beinhaltet, wofür es sich zu leben lohnen würde. Lieber möchte es sich auf eine gute und selbstbestimmte Art und Weise aus der Welt verabschieden. Ruft man sich ins Gedächtnis, wie akribisch Espedal die Erschaffung dieses Ichs über Jahrzehnte hinweg vorangetrieben hat, wird einem die Sprengkraft dieses ersten Satzes bewusst. Ohne große Umschweife strebt das Ich sein eigenes Ende an, für das es einen festen Zeitrahmen, nämlich den eines Jahres, ansetzt. Nur in Erwartung des Todesdatums lässt sich dann das Leben noch einmal in den vollsten Zügen auskosten. Es wirkt fast so, als beschwöre Espedal seine bereits etwas in die Jahre gekommene, autofiktionale Welt noch ein letztes Mal, um von ihr den Abschied nehmen zu können, der sich unvermeidbar anbahnt. Am markantesten ist dieses bevorstehende Loslassen allerdings in der Art des Erzählens angelegt, die sich ganz grundlegend von Espedals sonstiger Autofiktion unterscheidet. Obwohl wir es mit einem Ich zu tun haben, erzählt der Text von ihm – und nicht es den Text. Dies gelingt Espedal mit dem simplen, doch ebenso genialen Kniff, dass er seinem Protagonisten den Namen Ich gibt. Dadurch stellt er eine erfrischende Distanz zu seinem Ich her, die den Text lebendiger macht und ihm einen Rhythmus verleiht. Die ständigen Wechsel vom Namen ‚Han‘/ ‚Ich‘ hin zum Personalpronomen ‚han‘ /‘ich‘ sorgen für zahlreiche kurze Störmomente im Lesefluss. Ein hohes Maß an Aufmerksamkeit setzt der Text so von seinen Lesenden voraus, der oder die sich ununterbrochen dazu gezwungen sehen, die Frage nach dem ‚Wer bin ist Ich?‘ zu beantworten. Hiervon profitieren insbesondere Espedals tiefgründigere Überlegungen über das Leben, den Tod, Krankheit und Familie. An diesen Stellen öffnet sich der Text durch die unterschwellig mitschwingende Identitätsfrage und wird dadurch überraschend nahbar.
Ob diese Momente letztendlich durch den gesamten Roman tragen, ist nicht klar zu sagen. Tun sie das, ist Elsken mit Sicherheit ein äußerst originell erzählter und lesenswerter Roman, der sich genauso gut in Tomas Espedals Autofiktion einreiht, wie er ihr Ende verkündet. Somit käme ihm eine Schlüsselrolle in der Gesamtbetrachtung seines Schaffens zu. Tun sie das nicht, wirkt Elsken wie ein aus der Zeit gefallener Text, der kaum Neues mit viel Bekanntem verbindet. Über diese Innovationsarmut – oder handelt es sich hier gar um Verweigerung? – kann dann selbst kein noch so geistreicher erzählerischer Kunstgriff hinwegtäuschen.
Espedal, Tomas: Elsken. Roman. Oslo: Gyldendal 2018.
Espedal, Tomas: Lieben. Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Berlin: Matthes & Seitz 2021.
(Felix Bidder, Ludwig-Maximilians-Universität München)