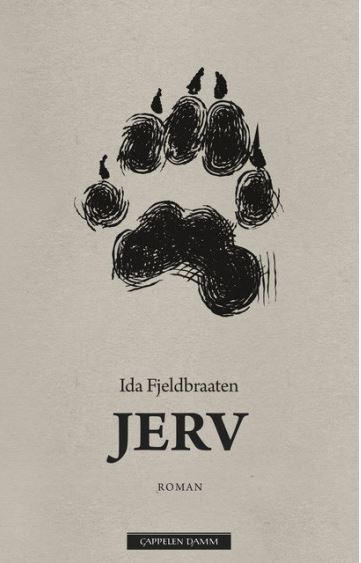„Det er ingen her. Jeg får bare begynne på egen hånd“ (S. 5, Es ist niemand hier. Ich muss eben allein anfangen), stellt die Ich-Erzählerin von Ida Fjeldbraatens 2020 erschienenem Roman Jerv fest, als ihr zu Beginn auffällt, dass die Wohnanstalt, in der sie zusammen mit anderen behinderten und schwer erziehbaren jungen Erwachsenen lebt, völlig verlassen ist. Sie duscht, putzt sich die Zähne, kämmt sich die Haare. Ein Blick in den Spiegel lenkt die Aufmerksamkeit auf ihren Körper, der ihr hinter der beschlagenen Scheibe nackt und zugleich diffus erscheint. Dieser uneindeutige Körper erweist sich im Laufe des Romans als Träger einer ebenso fragilen menschlichen Identität, die besonders dann ins Wanken gerät, wenn es um Tiere geht – um das Animale im Menschen, Begegnungen von Mensch und Tier oder tierische Perspektiven auf die Geschehnisse.
Diese thematische Rahmung ist in der skandinavischen Literaturgeschichte nicht wirklich neu. So wurde das Bild des Menschen als selbsternannter ‚Homo rationalis‘ in zahlreichen fiktionalen Texten verhöhnt, darunter Ludvig Holbergs von Gulliver’s Travels inspiriertem Nicolai Klimii iter subterraneum (1741), Johannes V. Jensens Edderkoppen (1907) oder – um ein rezenteres Beispiel zu nennen – Peter Høegs bekanntem Roman Kvinden og aben (1996); als Begleitfiguren oder gar Fokalisierungsinstanzen begegnen uns Tiere in der neueren Literatur außerdem auch in robinsonadenartigen Erzählungen wie Erlend Loes humoristischem Doppler (2004) oder Kerstin Ekmans Hunden (1986).
Fjeldbraaten greift solche Themen und Textverfahren auf, ihr Debüt Jerv durchzieht aber zugleich eine ebenso interessante wie potentiell provokative Parallelstellung zwischen Tier-Sein und Behinderung, deren Kulisse eine nicht näher definierte und vielleicht deshalb so unheimliche Krisensituation bildet: Trotz ihrer Erkenntnis, dass sie allein in der Wohnanstalt ist und weder die öffentlichen Verkehrsmittel fahren noch das Telefon funktioniert, macht sich die zwar pflichtbewusste aber oft etwas naive Protagonistin auf den Weg zur Arbeit – einem Provinz-Zoo, in dem sie als Putzkraft angestellt ist. Hier wird sie Zeugin zahlreicher Gewalttaten an Tieren: Uniformierte Männer und Frauen dringen in den Zoo ein, randalieren und erschießen die Tiere. Was genau passiert und was der Grund für die Ausschreitungen ist, erfahren die Leser:innen nicht, nur in vereinzelten Passagen ist die Rede von unterirdischen Bunkern, die für den Katastrophenfall ausgestattet werden, oder von Schlagzeilen in den Zeitungen über eine sich verschlechternde, aber im Roman nicht konkreter geschilderte politische Lage. Der Zoo befindet sich als eine Art Nicht-Ort an der Peripherie des hier angedeuteten Katastrophenszenarios.
In der norwegischen Literaturkritik wurde Jerv überwiegend positiv aufgenommen. Für Even Teistung (Klassekampen) etwa, der den Roman als Allegorie über das menschliche Einwirken in die Natur versteht, handelt es sich um ein bemerkenswertes Debüt. Ida Vågsether (Morgenbladet) sieht Jerv insbesondere als sprachlich gelungen und lobt den Entwurf einer verrohten Gesellschaft mit dystopischen Zügen, der sich abhebt von den vielen ich-zentrierten Autofiktionen der norwegischen Gegenwartsliteratur, wenngleich Vågsether jedoch nicht klar wird, worauf Fjeldbraaten mit diesem Gedankenexperiment hinauswill. Gerade die Deutungsoffenheit des Romans, der sich nicht zuletzt in seiner nur vage formulierten Anklage gegen derzeitige gesellschaftliche Verhältnisse von den klassischen Dystopien des 20. Jahrhunderts unterscheidet, bildet meines Erachtens aber seine Stärke. In jedem Fall nimmt Jerv, und darin sind sich alle Rezensent:innen einig, die Spezies Mensch kritisch in den Blick.
Der Kulturraum Zoo
Von den brutalen Geschehnissen im Zoo erfahren die Leser:innen abwechselnd aus der Perspektive der menschlichen Protagonistin und aus der Sicht eines im Zoo lebenden Vielfraßes. Die beiden Erzählstränge sind anfangs zeitlich versetzt: Während der Zoo in den Erzählungen des menschlichen Ichs bereits verwahrlost erscheint und abgesehen von der Erzählerin auch kein Personal mehr anwesend ist, schildert das tierische Ich die Zeit unmittelbar davor, in der die Menschen sich immer seltener sehen lassen und das Futter folglich immer knapper wird. Durch diese Schilderungen macht Fjeldbraaten den Kulturraum Zoo als Wohlstandsphänomen lesbar, das in Krisenzeiten aus der menschlichen Wahrnehmung verschwindet. In zahlreichen Rückblenden im Erzählstrang der Protagonistin werden zugleich kommerzielle Interessen problematisiert – ethischen Grundsätzen wie Tierwohl und Artenschutz kommt schon in Zeiten des Friedens eine untergeordnete Rolle zu, denn in den Erinnerungen der Protagonistin werden Tiere, die die Gäste nicht häufig genug besuchen, schlichtweg geschlachtet, und seltene Leihgaben anderer Zoos verkümmern an dem schmutzigen Wasser und dem schlechten Futter im Zoo des Romans. Sogar zwei der Rebell:innen erweisen sich in dieser Hinsicht ironischerweise als empathischer, als sie einem bereits angeschossenen Elch den Gnadenschuss geben – immerhin setzt das dem Leben des Tieres nicht bloß aus reinem Überdruss ein Ende.
Sprachreflexionen
Die oben erwähnte Parallelisierung des menschlichen und des tierischen Ichs wird bereits auf den ersten Seiten des Romans angedeutet, wenn man erfährt, dass es sich bei beiden Figuren um Außenseiter:innen handelt – die junge Frau ist wegen ihrer Beeinträchtigung häufig Hänseleien ausgesetzt und der Vielfraß wird von den anderen Tieren im Gehege aufgrund einer Schwellung an der Pfote verstoßen. Eine Ähnlichkeit wird aber auch dadurch suggeriert, dass der menschlichen Figur tierähnliche Eigenschaften zugeschrieben werden, während der Vielfraß anthropomorphe Züge erhält. So fallen der Protagonistin an mehreren Stellen Ähnlichkeiten des eigenen Verhaltens mit dem der Hauskatzen ihrer verstorbenen Mutter auf. Das Tierische prägt jedoch nicht nur ihre Eigenwahrnehmung, sondern wird ihr auch von anderen Figuren attestiert: Ihre Mutter vergleicht sie in einer Erinnerung etwa mit Pandabären, da deren Augen sich sehr ähnelten.
Während das Animale bei der Protagonistin insbesondere über Selbst- und Fremdwahrnehmungen impliziert wird, ist die Personifizierung des Vielfraßes an etwas anderen Textverfahren erkennbar: Der Vielfraß wird bereits dadurch vermenschlicht, dass er aus der Ich-Perspektive erzählt und damit in der Lage ist, Informationen sprachlich zu fassen, zu selektieren und zu strukturieren; teils analysiert er sogar das Verhalten der anderen Vielfraße im Zoo und fällt damit gänzlich aus der Rolle eines Tieres. Diese semiotische Befähigung des Vielfraßes wird im Text auffälligerweise durch einen sprachgeschichtlichen Blick auf die Bezeichnungen „Vielfraß“ im Deutschen und „fillefrans“ im Norwegischen ergänzt. An mehreren Stellen des Romans thematisiert die Protagonistin den Namen des Tieres, das sie als „fillefrans“ bezeichnet.
[I] bøkene lærte jeg at på tysk kaller de jerven for „Vielfraß“ som betyr storeter. Og, leste jeg, det tror jeg var på internett, at det var fra Vielfraß vi i Norge hadde laga ordet fillefrans som jeg syntes var passende på jerven med foten og både Veterinær-Mari og Erling syntes det var et fint navn som vi godt kunne bruke på ham, så nå gjør nesten alle i dyreparken det. (S. 52)
Aus den Büchern lernte ich, dass man das Tier [jerv, dt. „Vielfraß“] im Deutschen „Vielfraß“ nennt. Und, das las ich im Internet, glaube ich, dass wir vom deutschen „Vielfraß“ in Norwegen das Wort „fillefrans“ ableiteten, was ich für das Tier [jerv] mit der Pfote passend fand, und sowohl die Tierarzt-Mari als auch Erling fanden, Fillefrans sei ein schöner Name, der sich gut für ihn eignen würde, sodass ihn jetzt auch fast alle im Tierpark so nennen.
Das Tier erhält an dieser Stelle gleich drei verschiedene Bezeichnungen und damit verbundene Bedeutungen: Dem zunächst wertneutralen und im Norwegischen gängigsten Begriff „Jerv“, das laut etymologischem Wörterbuch vermutlich vom germanischen „*erba-“ für „braun“ abgeleitet ist und auf die dunkle Farbe des Pelzes referiert, folgen zum einen der Kosename „fillefrans“ und zum anderen ein Hinweis auf die Wortherkunft dieses Kosenamens, der im Roman mit dem deutschen „Vielfraß“ in Verbindung gebracht wird. Bei dem deutschen Wort handelt es sich – so ist es zwar nicht dem Roman, jedoch etwa dem Duden zu entnehmen – um eine inkorrekte Verwendung der norwegischen dialektalen Form von „fjeldfross“, das mit „Bergkater“ übersetzt werden kann. Als „fillefrans“ wird im Norwegischen wiederum eine verwahrloste Person oder ein Landstreicher bezeichnet. Beinahe überladen an Bedeutungen wird das Tier hier also lesbar als Spezies, die einen eindrücklichen braunen Pelz trägt, nimmersatt ist und an lumpig gekleidete Herumtreiber oder Katzen erinnert. Hinter Letzterem verbirgt sich im Übrigen auch ein textinterner Verweis auf den Tod der Mutter, die nach ihrem Ableben von den Hauskatzen angefressen wird, – auch der Vielfraß des Romans ist, da das Futter schließlich immer knapper wird, dem Menschenfleisch nicht abgeneigt. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Zootiere wegen des ebenso billigen wie spärlichen Futters zunehmend verwahrlosen, wirkt der Name „fillefrans“ mitsamt seiner sozioökonomischen Dimension ebenso passend wie ungewollt zynisch von der Protagonistin.
Dennoch wird das Tier mit vielen Namen belegt – im Gegensatz zu der menschlichen Protagonistin selbst, deren Name im Roman unerwähnt bleibt. Die Leser:innen erfahren lediglich, dass sie den Wunschnamen ihres Vaters – vermutlich wegen der Behinderung – nicht erhalten hatte. Nur ein weiteres Mal wird im Roman ihr Name thematisiert: Bei einem Besuch auf dem Hof einer Betreuerin, die sie aus dem Wohnheim kennt, werden einige Lämmer, bei deren Geburt die Protagonistin hilft, nach ihr benannt. Das Kapitel endet dann damit, dass die Lämmer von der Familie verspeist werden.
Sowohl in den Schilderungen über den Vielfraß als auch in denen über die menschliche Protagonistin werden verschiedene Ausformungen der Macht deutlich, die von der sprachlich-symbolischen Ordnung einer Kultur ausgehen, die als ebenso menschenzentriert wie latent behindertenfeindlich begriffen werden kann: Das Geschichts- und Trivialwissen über den Vielfraß, das die Protagonistin Büchern und Internetseiten entnimmt, bilden ein Konglomerat aus historischen Prozessen des Erschließens, Klassifizierens und (Um-)Deutens von Naturräumen ab, wie es etwa in der frühen Neuzeit Olaus Magnus und in der Aufklärung Carl von Linné praktizierten. Dabei verleugnet der Roman aber auch nicht seine eigene Verfasstheit als textuelles Medium, das stets in ein kulturell gewachsenes Wissen über Tiere eingebunden ist – ein Beispiel hierfür ist der Hunger des Vielfraßes auf Menschenfleisch, über den schon der erwähnte Olaus Magnus schrieb. In seinen Historien der mittnachtigen Länder (1562, dt. Ausgabe 1567) betont dieser den nimmersatten Appetit des Vielfraßes, der es nicht zuletzt auf Menschen abgesehen habe. Im Vergleich hierzu wird der menschlichen Protagonistin kaum eine symbolische Repräsentation zuteil, da ihr Name aus einer Negation – einer Verweigerung von väterlicher Zuneigung – resultiert und an Tiere weitergegeben wird, um in einem letzten Schritt einer aggressiven Zerstörung durch den Verzehr ebendieser Tiere zu unterliegen.
Grenzmarkierungen und -auflösungen zwischen Mensch und Tier
Tiere und beeinträchtige Personen werden im Roman immer wieder und sehr deutlich als soziale Außenseiter:innen markiert, die unter der Herrschaft der Rebellierenden besonders vulnerabel erscheinen. Durch ihre Uniformen und vereinzelte Begründungen ihrer Tötungen mit der Intention, leidende Tiere euthanasieren zu wollen, erinnern die Rebellierenden dabei teils an den Nationalsozialismus des zweiten Weltkrieges. In einer Passage des Romans mischen sich Fragen der Spezieszugehörigkeit mit solchen der geistigen Beeinträchtigung: Weil sie hungrig ist, schleicht sich die Protagonistin zu einem Kiosk des Zoos, wo sie Getränke, Burger und Würste findet. Nicht lange später klopfen zwei Rebellen an die Tür und die Protagonistin versteckt sich unter einer Theke, bevor sie in den Raum gelangen. Als einer der beiden ihr allerdings zu nahekommt, beißt sie ihm ins Bein. Bereits zuvor wird an einigen Stellen beschrieben, dass die Protagonistin wegen ihrer Behinderung häufig unvernünftig und aus dem Affekt heraus handelt, insbesondere wenn sie Hunger, Angst oder Wut empfindet. Vor allem während der Begegnung mit den Rebellen wird sie dabei als tierähnlich geschildert:
Mannen med beinet fortsetter å skrike. Det er et beist, hun beit meg! Skyt henne! Jeg snerrer mot dem, glefser etter beinet igjen. Ser du ikke, hun er jo ikke normal, skyt henne! Skriker han igjen. Han har løfta opp buksa, han blør fra beinet. Det er lyserødt og renner fort ned mot skoene hans. Se da, for faen. Jeg kommer til å få infeksjoner og rabies! Den andre løfter geværet mot meg, men ser usikker ut. Skyt henne, skriker mannen om igjen og om igjen. Høyere og høyere. Jeg freser. Det der er jo faen ikke et menneske engang! (S. 104f)
Der Mann mit dem Bein schreit weiter: „Das ist ein Biest, sie hat mich gebissen! Erschieß sie!“ Ich knurre sie an, schnappe ein weiteres Mal nach dem Bein. „Siehst du das nicht, sie ist doch nicht normal, erschieß sie!“, schreit er wieder. Er hat die Hose hochgezogen und blutet am Bein. Das Blut ist leuchtend rot und rinnt herab zu seinen Schuhen. „Schau doch, verdammt. Ich bekomme Infektionen und Tollwut!“ Der andere hebt das Gewehr gegen mich, sieht jedoch unsicher aus. „Erschieß sie“, schreit der Mann immer und immer wieder. Lauter und lauter. Ich fauche. „Verdammt, das ist ja noch nicht einmal ein Mensch!
Der Protagonistin gelingt es zu flüchten. Sie rennt in ein Wäldchen, das noch zum Zoogelände gehört und in dem sich auch das Gehege der Vielfraße befindet. Hier angekommen findet sie den abgemagerten Fillefrans als einziges noch lebendes Tier des Rudels vor. Die Protagonistin, die sich mittlerweile ihres eigenen animalen Verhaltens bewusst geworden ist, beginnt nun, sich der eigenen Menschlichkeit zu vergewissern. Das geschieht zum einen über das Erinnern an Erlebnisse mit den Hauskatzen in ihrer Kindheit und über ein reflexives Verarbeiten der Geschehnisse im Kiosk, zum anderen aber auch über die Sorge um den halbtoten Vielfraß, den sie nun gesundpflegen möchte.
Mit dieser erneuten Menschwerdung der Protagonistin mittels kognitiver Prozesse verbindet sich auf den ersten Blick eine Unstimmigkeit im Roman, die sich bei genauerer Betrachtung jedoch als fruchtbar erweist, da durch sie ethische und anthropologische Problemstellungen zutage treten: Wenn Menschlichkeit an geistige Leistungen wie Selbstreflexion oder die Fähigkeit, für andere Sorge zu tragen, gebunden ist, drängt sich die Frage auf, ob das nicht im Gegenschluss auch all jenen die Humanität abspricht, die hierzu, etwa aufgrund schwerer Behinderungen, nicht in der Lage sind. Seine eigene Logik unterläuft der Roman jedoch bereits, wenn er die Frage nach dem spezifisch Humanen von vornherein verwirft, indem das Reflektieren und Erinnern als Fertigkeiten nicht dem Menschen vorbehalten bleiben – schließlich ist auch der Vielfraß zu beidem in der Lage. Die Verschränkung von geistiger Behinderung mit Animalität in Jerv mag vielleicht, wie weiter oben erwähnt, provokant sein; Fjeldbraaten gelingt es mit solchen Passagen jedoch, sie für die zentralen ethischen Fragestellungen des Romans produktiv zu machen.
Neben Speziesgrenzen hebelt der Roman außerdem humanitäre Werte als Grundpfeiler eines aufgeklärten Wohlfahrtsstaates aus, denn die Protagonistin bleibt im Roman die einzige, die sich um andere zu kümmern scheint: Die weiter oben erwähnte Heimbetreuerin verschwindet etwa nicht spurlos, sondern kündigt ihr Fortgehen, wie man zum Ende des Romans erfährt, in beinahe schadenfroher Manier schon einige Tage zuvor an; und nicht erst angesichts der Krisenlage erweisen sich die Figuren als sadistisch; in Erinnerungen der Protagonistin ist von Jägern zu lesen, die ihre Beute langsam ausbluten lassen, von Pförtnern im Heim, die sich nachts SM-Pornos anschauen, oder von Heimbetreuern, die die noch kindliche Protagonistin sexuell misshandeln. Humanitarismus und Empathie als (vermeintliche) Sonderstellungsmerkmale des Menschen sind in Fjeldbraatens Jerv also höchst fragile Konstrukte sozialer Ordnungen, die in Zeiten des Friedens bereits bröckeln und in Krisensituationen zusammenbrechen. Sowohl zwischenmenschliche als auch speziesübergreifende Verhältnisse werden im Roman stattdessen als quasi-parasitäre Bindungen erzählt, die nicht selten auf eine bloße Befriedigung basaler Triebe des Stärkeren reduziert erscheinen.
Von dieser Regel bilden auch die Interaktionen zwischen der Protagonistin und Fillefrans im Übrigen keine Ausnahme. Bei der Darstellung der Beziehung beider Figuren zueinander bedient sich die Autorin einer kurzen Geschichte aus Plutarchs Lykurgos: Ein junger Spartaner habe sich einmal von einem Fuchs fressen lassen, den er unter seiner Kleidung verborgen hielt und zuvor gestohlen hatte, da er, wie bei der Erziehung der Jungen in Sparta durchaus üblich, nur spärlich zu essen bekam. Den Diebstahl jedoch wollte er nicht zugeben, weil er hierdurch seine Ehre bedroht sah. Die Protagonistin aus Jerv missversteht die Geschichte jedoch und verklärt sie damit zugleich: Der Junge habe sich den Fuchs als Haustier gehalten und die Geschichte sei ein Zeugnis rückhaltloser Zuneigung des Kindes zu dem Tier. Indem sie diese Lesart nun mit ihrer Beziehung zu dem Vielfraß analogisiert, projiziert sie ihre eigenen Sehnsüchte nach Zuneigung und Anerkennung auf das Tier, verkennt dabei allerdings dessen Bedürfnisse als Raubtier. In dieser Fehlinterpretation deutet sich folglich eine unüberwindbare Kluft zwischen Mensch und (Raub-)Tier an; zugleich verweist die Geschichte in ihrem ursprünglichen Sinn auf das Ende des Romans von Fjeldbraaten: Für den inzwischen befreiten Vielfraß muss die Protagonistin als Futter herhalten.
Ida Fjeldbraaten: Jerv, Oslo: Cappelen Damm, 2020
(Maja Martha Ploch, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)