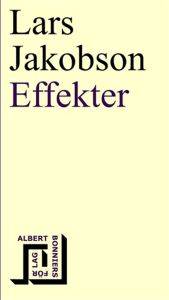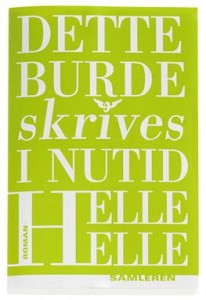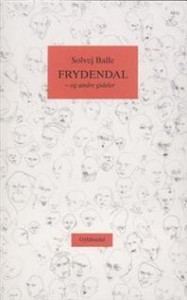Konspiratives Monument der eigenen Autorschaft? Lars Jakobsons Essayband Effekter (2011)
Das Maß an Ironie, mit dem Lars Jakobson seine eigenen Werke präsentiert, lässt sich schwer abschätzen. Passend zu einem seiner Schlüsselthemen – der eigenwilligen Verschmelzung von science fiction und Dokumentarismus – wird der Band Effekter sowohl als Klassiker der Zukunft als auch im minimalistischen Retro-Look der 1960er Jahre dargeboten. Nicht wenig prätentiös sind auf den beiden Umschlagklappen „böcker av bestående värde från alla tider“ (Bücher von bleibendem Wert aus allen Epochen) aufgelistet; zwischen Den amerikanska storstadens liv och förfall (Jane Jacobs 1961) und Pappan och havet (Tove Jansson 1965) reihen sich Jakobsons Romane Kanalbyggarnas barn, Vid den stora floden (1997 und 2006) ein.
Von Seiten der schwedischen Literaturkritik gilt der Roman I den röda damens slott (2000) als Durchbruchserfolg, nicht zuletzt weil in dieser ‚marsianischen Biographie’ das intrikate und suggestive Programm eines kontrafaktischen Schreibens überzeugend demonstriert wurde. Jakobsons jüngster Roman Vännerna (2010) bezieht darüber hinaus das essayistische Prinzip stärker ein: assoziative und sprunghafte Übergänge; Fragmente, die sich in einem allmählich wachsenden Netz der Kommentierungen wechselseitig beleuchten. In diesem umfangreichen Textpool tritt diejenige Instanz, die lange Zeit ‚impliziter Autor’ genannt wurde, als ein unzuverlässiger Arrangeur auf, der sich aus unterschiedlichen subjektiven und anerkannten Textarchiven zugleich bedient. Dieses weder chronologische noch selbsterklärende Prinzip kommt in Effekter ebenfalls sinnreich zur Anwendung.
„Effektförvaring“ heißt Gepäckaufbewahrung, und die Sammlung ist in der Tat ein Archiv für die 25 Texte, die unterwegs waren und weiterhin in der Zirkulation bleiben; sie sind nur vorläufig im Rahmen einer Herausgeberfiktion fixiert. Das Vorwort ist nämlich von der fiktiven Figur Joan Bravais verfasst, die betont, dass die versammelten Essays auch als Selbstkommentare des Autors dienen: „Effekterna på och effekterna av hans tro på fiktionen“ (S. 6; Die Konsequenzen für Jakobsons Glauben an die Fiktion und die Folgen dieses Glaubens).
Die Überschrift des Vorworts lautet „Lars Jakobson (1959-2010)“ und verkündet einmal mehr den Tod dieses und jenes Autors, zugleich aber auch dessen Wiederauferstehung als Essayist, so dass der Roman Vännerna von 2010 demnach in die neue Ära fällt. Die Autorschaft durchläuft damit eine selbstgewählte Transformation, die durch das mittlerweile trendy gewordenen Sterbenlassen einer Autorfigur oder eines anderen Stellvertreters proklamiert wird (wie etwa auch bei Claus Beck-Nielsen oder Vibeke Tandberg).
Wie kann sich nun das einzelne Essay in diesem diffizilen Dickicht behaupten? Nach der Lektüre von Effekter scheint mir das Umkreisen und Umschreiben als ein zentrales Verfahren: Dem Essayisten ist gestattet, sein Ziel auf planvolle Weise zu verfehlen und den Weg selbst so ertragreich wie möglich zu gestalten. Mit entsprechendem Verarbeitungsabstand mögen aus Jakobsons Perspektive die eigenen Texte vielleicht sogar von Gepäck- zu Fundstücken zu werden, deren Beschaffenheit man sich neu in Erinnerung rufen muss und die sich dann womöglich – in den inzwischen verwandelten Kontexten – auf nicht vorhersehbare Weise entfalten. Erst im Nachhinein kann so rekonstruiert werden, wie Gedankenlinien vorbereitet worden sind.
Das Thema artificial intelligence hat Jakobson beispielsweise schon ein Jahrzehnt lang beschäftigt (siehe das Essay „AI“, 2001). Es erstaunt ihn, dass keine kontroverse Debatte über lernfähige, genetisch programmierte Roboter wie etwa Elvis und Priscilla geführt wird. Diese beiden figurativen AI-Computer wurden an Chalmers tekniska högskola in Göteborg entwickelt und sollen in der Industrieproduktion und in Fürsorgeeinrichtungen eingesetzt werden. Laut Jakobson hat die Literatur geradezu den Auftrag, die Potentiale und Gefahren von Mensch-Maschine-Gebilden genau auszuleuchten. Dieser Beitrag ist zunächst wie eine Wissenschaftsreportage mit Interview-Anteilen gehalten, bevor er in ein Resümee von science-fictions übergeht. Die sich abzeichnende Unmöglichkeit, die kognitive, und die emotionale Kompetenz von Menschen und AI-Computern voneinander unterscheiden zu können, wird in knapper Form erörtert.1 Sind ein realisierbarer freier Wille und eine willentlich gesteuerte Veränderlichkeit des Selbst die letzten Merkmale des Menschlichen? Wird man in die Lage kommen, den AI-Computern bestimmte Rechte zuzusprechen, weil sie sogar das Lernen erlernen können? Eine Andeutung von maschineller Selbstreflexion ist unbestreitbar, wenn beschrieben wird, wie Elvis, lediglich von einer Zielvorgabe ausgehend, den Bewegungsprozess des Gehens selbstständig erlernt, nachdem er ein wenig ratlos mit den Hüften gewackelt hat. Auch auf den ambivalenten menschlichen Bedarf der Anthropomorphisierung von AI-Robotern wird eingegangen. Der besondere Reiz des Beitrags besteht darin, dass ihm ein (später verfasster) literarischer Text vorangestellt wird: „Matrioska“ (2009) behandelt die sich steigernde Bewegungseinschränkung eines Menschen. Eine Frau ist auf einer Wanderung mit ihrem Partner an ihrem ‚weltergreifenden und lebenshungrigen’ Gehen zunehmend gehindert, weil sie – angeblich zu ihrem eigenen Schutz – sukzessive mit einer metallischen Hülle versehen wird. Nachdem Matrioskas Partner sogar ihr Visier luftdicht verschlossen hat, ist sie äußerlich von einem Roboter nicht mehr zu unterscheiden. Der Schöpfungsmythos, das Pygmalionthema oder auch das Diktum „killing women into art“ treten hier in sehr überraschenden Varianten auf. Im P.S. dieses Beitrags kommt die Erstleserin („min fru“) in genüsslich-sarkastischem Ton zu Wort: „Med några färgglada illustrationer skulle det här kunna bli en rätt odräglig bilderbok.“ (Versehen mit ein paar farbenfrohen Illustrationen könnte das doch ein ziemlich widerliches Bilderbuch werden.)
Die Textbeziehung von „AI“ zu „Matrioska“ führt dazu, dass der potentielle symbolisch-allegorische Gehalt des literarischen Textes niedrig erscheint. Das Szenario der ungewissen Zukunft soll gerade in konkreten Episoden nachvollzogen werden. Dem Autor geht es nicht darum, Chiffren zu finden, die den Lesern nahelegen, eine andere oder eigentlich gemeinte Geschichte zu dekodieren.
Auch die literaturwissenschaftlich fundierte Reportage über Per Olof Sundmans Werkbiographie (S. 91-155), passagenweise szenisch und protokollarisch dargeboten, ist in einem science-fiction-Rahmen ‚aufgespannt’, wie der Titel „Översten kom tillbaka från Ingenting-alls“ und das Motto von Cordwainer Smith signalisieren. Dieses zentrale Essay liefert sowohl literaturwissenschaftliche Deutungsansätze am Beispiel von Sundmans Kurzgeschichte „Vadaren“ (Der Watende, 1972) als auch eigene Recherchen zu Sundmans pro-nazistischen Aktivitäten. Zugleich werden die vermeintliche Aufdeckung von Sundmans Schuld in der Forschung und eine versteckte Thematisierung des ‚dunklen Geheimnisses’ nachdrücklich dementiert. Dass Jakobson sich mit einem Autor auseinandersetzt, der zum – sogar ethisch fundierten – Widerspruch reizt, ist für die eigene Inszenierung der Autorschaft von großer Bedeutung. Der erwähnte Autor C. Smith ist nicht allein für seine science-fiction-Prosa (z.B. die Erzählung „The Colonel Came Back from the Nothing-at-All“) bekannt, sondern auch für seine Fachbücher zur psychologischen Kriegsführung 1958-65.
Wie nun eine Dreiecksrelation zwischen Sundman, Smith und Jakobson aufgebaut wird, lässt sich in zwei Schritten nachvollziehen: Nachdem die Spur zu C. Smith als Vergleichsautor für Sundman gelegt worden ist, wird nun Sundmans Genreentwurf eines „provinsialisk science fiction“ (1958, vgl. S. 147) als Komponente der Jakobsonschen Poetik präsentiert. (Dies lässt sich allerdings erst aus dem Kontext sämtlicher Essays erschließen und im Vorausgriff auf die 2003 erschienene Anthologie Stjärnfall. Om sf, verfasst von Lars Jakobson, Ola Larsmo, Steve Sem-Sandberg.) Sundman erläutert den ‚provinziellen sf’ wie folgt:
„Det är ju så att väl praktiskt taget alla framtidsvisioner har en sorts kontinental storstadsmiljö som bakgrund (antingen de utspelas i miljonstäder eller i ett vilsekommet rymdskepp). Men vi måste ändå liksom tänka oss att i framtiden skall det även finnas avlägsna landsdelar, långt-bort-boende människor som inte sett raketskepp annat än på vykort. Och jag menar, att på samma sätt som man nu kan återfinna tätortsmänniskornas ogripbara problem återspeglade i glesbygdsmänniskans gripbara samhälle, på samma sätt skulle man kunna skapa en gripbar vision av framtidens fantastiska utvecklingsmöjligheter för de stora människoanhopningarna genom att försöka ’prekonstruera’ de vid-sidan-om-liggande landsdelarna.” (1958, S. 147f.; Im Grunde genommen verwenden alle Zukunftsvisionen eine Art kontinentale großstädtische Umgebung als Ausgangspunkt (unabhängig davon, ob sie die großen Metropolen oder ein verirrtes Raumschiff als Schauplatz haben). Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass es auch zukünftig abgelegene Regionen geben wird, weit außerhalb lebende Menschen, die eine Rakete nur auf einer Postkarte gesehen haben. Und ich meine, dass man eine nachvollziehbare Vision der phantastischen zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten für die Orte mit großen Menschenansammlungen entwerfen kann – ebenso wie man die unfassbaren Probleme der Menschen in den dicht besiedelten Gebieten durch eine Übertragung auf die überschaubaren Gesellschaften der dünn besiedelten Gebiete fassbar machen kann – indem man eine vorausschauende Konstruktion der marginalen Regionen entwirft).
Jakobson spinnt diesen Gedanken weiter, wobei es ihm nicht allein auf das dystopische bzw. utopische Zukunftsszenario ankommt, sondern insbesondere auch auf die realistisch-konkrete Verankerung der optionalen Welt. Das Pendant zu den marginalen Gebieten (bei Sundman) sind die bei Jakobson dargestellten historischen Räume und die Raumschiff-Welten, wobei beide in einer charakteristischen Verschränkung auftreten. Wie sich im Anspruch einer generellen und raumübergreifenden Detailtreue verrät, soll auch die wiedererkennbare Raumschiff-Welt der Forderung einer ‚realistisch-konkreten Verankerung’ unterstellt sein – wie sie sich tatsächlich bereits häufig in der science-fiction-Literatur manifestiert, wenn technische oder wissenschaftliche Exkurse Authentizitätsversicherungen geradezu ausstellen. Die Wiedererkennbarkeit wird paradoxerweise insbesondere durch eine dichte Intertextualität des Genres science-fiction erzielt.
Die Dimension des kontrafaktischen Erzählens nimmt zwar die Sundman entliehene Zielvorgabe zum Ausgangspunkt, verlangt aber darüber hinausgehend, dass sich dieser Zugang von der herkömmlichen kontrafaktischen Geschichtsschreibung absetzt. Im Essay „På vilken strand vid vilket hav?“2 zitiert der Autor eine eigene Tagebuchaufzeichnung über eine ABF-Buchpräsentation: Der dort auftretende Autor habe ein alternatives Geschichtsszenario entworfen, wie sich nämlich ein nationalsozialistisches Schweden, das einem großdeutschen Reich unterstellt sei, gestalten könnte. Ein solches Ansinnen wehrt Jakobson als trivial und unredlich ab, um sein eigenes Credo noch deutlicher herauszustellen:
„Romanen, som form, ställer inte lägre krav på akribi bara för att den har en annan syftning än historieforskningen. Eller den sociologiska undersökningen. Eller den psykologiska fallstudien. En uttalat kontrafaktisk fiktion, som mer än andra berättelser bygger på att ett tydligt ramverk övertas från den faktiska historien, måste alltid, implicit och/eller explicit, kunna förklara sina brott mot detta ramverk. Om inte så blir fiktionens berättelse, dess kritik eller utsaga, meningslös. Dess rum tomt.” (S. 200; Die Form des Romans stellt keine geringeren Ansprüche an die Genauigkeit, nur weil er andere Intentionen verfolgt als die Geschichtsforschung. Oder die soziologische Untersuchung. Oder die psychologische Fallstudie. Eine dezidiert kontrafaktische Fiktion, die mehr als andere Erzählungen eine markante Rahmung erfordert, die aus der faktischen Geschichte übernommen wird, muss stets – sei es implizit und/oder explizit – ihre Verstöße gegen diesen Rahmen rechtfertigen können. Sonst bleiben die fiktionale Erzählung, ihre Kritik oder Stellungnahme sinnlos. Ihr Raum leer.).
Nach dem ‚Tod des Romanautors’ ist nun abzuwarten, ob die essayistische Ästhetik weiterhin mit diesen Rahmenkonstruktionen arbeiten oder eine Entgrenzung stattfinden wird und auf diese Weise andere Markierungen der Literarizität erfolgen.
Bleibt nur nachzutragen, dass Jakobsons Verfahren einer vehementen Betonung der suspension of disbelief bei gleichzeitiger Wahrung der Realitätseffekte voraussetzt, dass die Lesenden viel Expertise mitbringen müssen, nicht nur die ‚männlichen Klassiker’ und den privaten Jakobson-Kanon, sondern auch populäre science-fiction-Texte betreffend.
Um auf die eingangs erwähnte Werkliste auf dem Umschlag, von John Ashbery bis Roger Zelazny, abschließend noch einmal zurückzukommen: Unverständlich bleibt, warum nirgends auf Lotta Lotass Romane verwiesen wird, die sich durch kontrafaktisches Erzählen (z.B. Tredje Flykthastigheten 2004) und nicht zuletzt eine Detailbesessenheit (z.B. Den svarta solen 2009) auszeichnen, die Jakobsons Akribie in nichts nachsteht. Sollte dieses Konkurrenzverhältnis vielleicht sogar eines der verschwiegenen abseitigen Elemente in der Autorschaft Jakobsons sein?
1 Mittlerweile drängen sich Bezüge zum Roman Alles, was wir geben mussten von Kazuo Ishiguro 2005 und zum Film Moon (Regie Duncan Jones, 2009) auf.