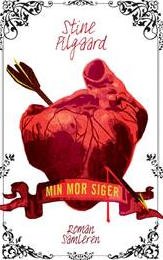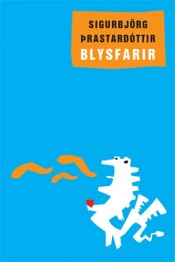 Der Gedichtzyklus Blysfarir aus dem Jahr 2007, der 2009 für den Literaturpreis des Nordischen Rates nominiert wurde, ist Sigurbjörg Þrastardóttirs vierter Lyrikband. Nach ihrem Debut im Jahr 1999 mit dem Gedichtband Blálogaland hat sie neben Gedichtbänden und Theaterstücken auch einen Roman veröffentlicht (Sólar Saga, 2002). Der Münchner Blumenbar Verlag hat 2011 die, von Kristof Magnusson übersetzte Ausgabe von Blysfarir unter dem Titel Fackelzüge veröffentlicht. Die Gedichte der Autorin habe einige Gemeinsamkeiten, so spielen in allen vier Bänden die von Marc Augé als „Nicht-Orte“ bezeichneten Transiträume der globalisierten Welt eine entscheidende Rolle.
Der Gedichtzyklus Blysfarir aus dem Jahr 2007, der 2009 für den Literaturpreis des Nordischen Rates nominiert wurde, ist Sigurbjörg Þrastardóttirs vierter Lyrikband. Nach ihrem Debut im Jahr 1999 mit dem Gedichtband Blálogaland hat sie neben Gedichtbänden und Theaterstücken auch einen Roman veröffentlicht (Sólar Saga, 2002). Der Münchner Blumenbar Verlag hat 2011 die, von Kristof Magnusson übersetzte Ausgabe von Blysfarir unter dem Titel Fackelzüge veröffentlicht. Die Gedichte der Autorin habe einige Gemeinsamkeiten, so spielen in allen vier Bänden die von Marc Augé als „Nicht-Orte“ bezeichneten Transiträume der globalisierten Welt eine entscheidende Rolle.
In Blysfarir wird, in einem ausgesprochen dicht gewobenen Text, die leidenschaftliche Liebesbeziehung einer Ich-Erzählerin mit einem Mann aus Berlin geschildert. Die Drogenabhängigkeit ihres Partners wird bereits am Anfang des Textes deutlich:
en núna / þegar hann ber við blossandi næturbirtuna fyrir utan kofann / þar sem hann stendur ósofinn og fókuserar og kveikir undir álinu, / núna er eins og eitthvað stígi upp í birtunni og ég heyri snöggt í / lungum og það báðnar og snarkar og ég sé hann, drekann
aber jetzt / als er vor der hütte aus dem gleißenden nachtlicht ragt / schlaflos dort steht und konzentriert guckt und das / alu anfeuert, da ist es als würde etwas aufsteigen in das licht / und ich höre kurz seine lungen und es schmilzt und / knackt und ich sehe ihn, den drachen
Die Drachenmetapher zieht sich isotopisch durch den gesamten Text und erzeugt auf zwei Ebenen Bedeutung. Im engeren Sinne bezeichnet sie immer wieder die konkrete Drogensucht des Liebhabers, der schließlich auch die Beziehung zum Opfer fällt. Die wiederkehrenden Verbindungen zwischen der Drachen-Jagd mit der Farbe Weiß lassen auf die Droge Crystal Meth schließen, deren Konsum umgangssprachlich auch als „den weißen Drachen jagen“ bezeichnet wird. In einer weiter angelegten Deutung kann die Drachen-Jagd auch als Metapher für das Streben nach dem nächsten, stärkeren Rausch stehen. Dieses Streben bezieht sich nicht nur auf den Drogenkonsum und die Sehnsucht nach einem neuen, besseren „High“, sondern auch auf die Grundstruktur der Beziehung zwischen der Ich-Erzählerin und ihrem Partner. Die Interaktion der Beiden, die bezeichnenderweise hauptsächlich im Präsens geschildert wird, ist geprägt von der zeitweilig beinahe kindlich anmutenden Suche nach neuen Abenteuern, sexuellen Extremsituationen und Grenzüberschreitungen, die vom Diebstahl bis zum Geschlechtsverkehr auf dem Friedhof reichen. Dass auch die Beziehung Suchtcharakter besitzt, wird von der Autorin herausgearbeitet, indem sie wiederholt Schilderungen des Drogenkonsums und Beschreibungen von Sex nebeneinander stellt.
Das Konzept strukturbildender Metaphern, die im Rahmen des Textes eine enge und eine weite Deutung zulassen, findet sich im gesamten Gedichtzyklus. Beispielhaft sei hier die wiederkehrende Verwendung der Farben Weiß und Blau zu nennen. Während die Farbe Weiß in verschiedenen Sprachbildern auftaucht, unter anderem im Kontext der Jagd nach dem weißen Drachen, in der weißen Farbe, mit welcher der Geliebte ihr isländisches Haus anstreicht, und auch in den titelgebenden Fackeln, die als weiße Fackeln bezeichnet werden, wird die Farbe blau immer wieder mit Milch in Zusammenhang gebracht:
og svo stend ég á flugvelli með galopna, bláa og hvíta mjólkurfernu / tveggja lítra og armana útrétta
dann stehe ich / am flughafen mit weit aufgerissenem, weißblauem milchkarton / zwei liter und ausgebreiteten armen
Der blaue Milchkarton kann im Kontext der Herkunft der Ich-Erzählerin sehr einfach als Symbol für die isländische Heimat gedeutet werden; so ist die besonders fetthaltige isländische Milch bekannt für ihren blauen Milchkarton. Folglich wird im Text ein Gegensatz zwischen Island, hier vor allem der isländischen Natur, und der urbanen Metropole Berlin erzeugt:
mér finnst / grundsamlegt hvað næturnar eru svartar / í kringum jarðhæðina hans / en bjartar / í kringum húsið mitt hvítt / í kringum kofann og fjöllin
verdächtig / scheint es mir wie schwarz die nächte / um sein erdgeschoss sind / und wie hell / um mein haus mein weißes / um die hütte und die berge
Dieser Dualismus findet sich auch an anderen Textstellen, wenn sich zum Beispiel das Naturerleben in der Großstadt auf eine rein medial vermittelte Realität stützt, da die beiden Protagonisten im Schutz ihrer Wohnung Tierfilme anschauen. Bei ihrem Aufenthalt in Island bezeichnet die Ich-Erzählerin die scheinbare Empfindungslosigkeit ihres Geliebten der isländischen Natur gegenüber als „Anhedonie“, also als Unfähigkeit, Freude zu empfinden. Diese Abstumpfung seiner Umwelt gegenüber ist verknüpft mit der Suche nach stärkeren Reizen, die nur im Drogenrausch möglich sind.
Die Beschreibung einer authentischen isländischen Natur und das Unvermögen des urbanen Menschen, diese auf sich wirken zu lassen, ist für sich betrachtet kein besonders innovatives Sujet. Doch eine weitergefasste Deutung der Metapher von der blauen Milch zeigt, dass der komplexe Gedichtzyklus sich eben nicht auf diesen althergebrachten Antagonismus von gesunder Natur und krankmachender Urbanität verlässt, sondern diesen bricht und in Frage stellt: Sinkt der Fettgehalt von Milch, dann wird die Milch bläulich. Blaue Milch entspräche demnach eben nicht der vollen Kraft der Natur, sondern wäre nur ein wässriges Destillat des Ausgangsproduktes. Die Schönheit der isländischen Natur trägt im gesamten Gedichtszyklus, dieser Lesart entsprechend, nicht zur Heilung der Drogensucht bei. Stattdessen werden Parallelen gezogen zwischen der Erhabenheit der Natur und der Bedrohlichkeit des Drogenkonsums, indem zum Beispiel die Ich-Erzählerin den von Entzug geplagten Geliebten mit einem erfrorenen Jungen im isländischen Hochland vergleicht. Ebenso wie die Natur ihre Anziehungskraft aus dem Wechselspiel von Gefahr und Schönheit gewinnt, verliert der drogensüchtige Liebhaber während eines letztlich erfolglosen Entzugs in den Augen der Ich-Erzählerin an Anziehungskraft.
Gleichzeitig werden in Blysfarir typische Klischees isländischer Naturdarstellung vermieden, da sowohl die Stadt Berlin als auch die isländische Natur als „Orte“ geschildert werden, die mit historischer Bedeutung angereichert sind. Dieser Vergangenheitsbezug äußert sich zum Beispiel in Saga-Referenzen oder der ausführlichen Schilderung eines Berliner Friedhofs. Diese „Orte“ stehen, um noch einmal Mark Augé aufzugreifen, im Widerspruch zu den offenen und unbeschriebenen Transiträumen. Der Gedichtzyklus handelt so auch von der Sehnsucht, die Liebe aus dem Bereich des Möglichen und des Abenteuers an einen konstanten Ort der Verbindlichkeit zu überführen. Stattdessen bleibt die Beziehung ein auf der Performanz des Moments basierendes Spiel, indem sich die Protagonistin zeitweilig selbst nicht mehr erkennt:
heim í úfið rúm / þar sem hann mun sjálfur liggja / upptrektur og horfa á beinasleggjuna sína í / hvössum stígvélum, í streng og með hatt, / veit ekki með svipu / því það er / ekki ég
nach haus in ein aufgewühltes bett / wo er selber liegen wird / aufgedreht und den dürren körper betrachten wird / in spitzen stiefeln, g-string und mit hut / und vielleicht peitsche, ich weiß es nicht / denn das bin / nicht ich
Am Ende des Textes haben sich die beiden Liebenden getrennt, und die Erzählerin ist zurückgekehrt nach Island. Die immer grotesker werdenden Bilder verdichten sich in der finalen Schilderung einer Geburtsszene, die als Choral bezeichnet wird. Die Bezeichnung knüpft an die zahlreichen offenen und verdeckten Religionsanspielungen an, die sich im Text finden lassen, zum Beispiel, als der Geliebte sich bei ihr für „die herrlichkeit, die kraft des moments“ S. 119 („takk fyrir dýrðina, máttugu andartökin“ S.121) bedankt und damit eine klare Umkehrung der letzten Zeile des Vaterunsers verfasst. Das Ende von Blysfarir wird so lesbar als eine Integration der „Kraft des Moments“ in das Leben der Ich-Erzählerin, die von sich selbst sagt, dass sie eine lodernde weiße Fackel aufrecht hält.
Sigurbjörg Þrastardóttir: Blysfarir. JPV Útgáfa, 2007
(Berit Glanz, Greifswald, Mai 2012)