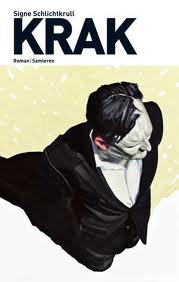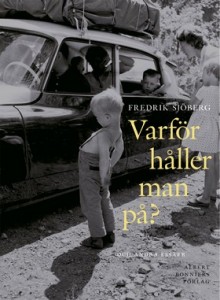 Glanzvoll schlingernd. Fredrik Sjöbergs Sammlung Varför håller man på? och andra essäer (2011)
Glanzvoll schlingernd. Fredrik Sjöbergs Sammlung Varför håller man på? och andra essäer (2011)
Der thematische Gegenstand torkelt, mehrfach wechselt er die Gestalt und entwindet sich dann seiner Beschreibung, keilt zu den Seiten aus und wildert in angrenzenden Gebieten, um unvermittelt wieder zum Pfad der Betrachtung zurückzukehren.
Sjöbergs Essays sind solchen beweglichen und wandelbaren Gegenständen gewidmet: Es geht etwa um das Wort ‚Bing’ oder um Briefmarkensammlungen, umgangssprachliche Ausdrücke für die menschlichen Genitalien, Ludwig Tieck, die Frühzeit des Naturschutzes, Lenin in Stockholm oder die Erfindung der Tasche. Zu allererst finden die Themen ihren Darsteller Sjöberg – und nicht umgekehrt –, der sich deren Bedeutung erst allmählich im Laufe seiner Überlegungen bewusst wird. Als neugieriger Sammler nimmt sich Sjöberg der gefundenen Merkwürdigkeiten und (auto)biographischen Souvenirs an, die sukzessive seinen weitverzweigten Erfahrungsschatz auffächern. Dass der Autor lange als Entomologe tätig war, rechtfertigt die Einschätzung, dass hier ein genauer Beobachter nach einem eigenwilligen poetischen System sammelt und reflektiert.
Die Struktur vieler Essays entspricht der Denkfigur eines Mäanders, wie der zentrale Text der Sammlung „Om essäkonsten“ (Über die Kunst des Essays) exemplarisch verdeutlicht. Zu Textbeginn ist die Ökonomie der Leser-Aufmerksamkeit zu beachten und ein unwiderstehlicher Aufhänger zu finden: „LÅT OSS ETT ÖGONBLICK tala om pengar. Mycket pengar. Guld. I tunnor!“ (S. 45, ‚LASSEN SIE UNS KURZ über Geld sprechen. Viel Geld. Gold. Tonnenweise!’). Wenige Zeilen später erfolgt das Geständnis, dass eigentlich ein anderes Thema auf dem Programm stehe. Anschließend werden unterschiedliche Essay-Definitionen unterbreitet, gebilligt oder verworfen, um dann konsequent mäandernd festzuhalten, dass Essays eine Kurzprosa-Form bezeichneten, von der wohl niemand genau wüsste, wie sie einzuordnen sei. Doch ist dies keineswegs eine irritierende Auslöschung des bisher Gesagten, sondern die Leser werden auf unterhaltsame Weise über ihre eigenen Vorerwartungen und Denkwege in Kenntnis gesetzt.
Lesevergnügen entsteht auch dadurch, dass wir Gewicht und Relevanz der behandelten Gegenstände selbst abschätzen müssen. Dabei haben die skurrilen Themen einen besonders befreienden Charakter, indem sie die in der Regel kaum eingeweihten Leser zur üppigen Assoziationsbildung anstiften. Das Motiv des Wohnwagens bei Gunnar Ekelöf („Ekelöf i sommarnatten“) verheißt beispielsweise nach ausufernden und selbstvergessenen Recherchen des Literatur-Sammlers nichts Geringeres als das Sublime: „Ängen står orörd framför plexiglasfönstret“ (S. 97, ‚Vor der Plexiglasscheibe die unberührte Wiese’, aus Ekelöfs Vägvisare till underjorden, 1967). Auf Ekelöf werden wir noch einmal zu sprechen kommen.
Doch zurück zu den mit Gold gefüllten Fässern und Tonnen. Mit diesen glitzernden Reichtümern gelingt es dem Ich-Erzähler in „Om essäkonsten“, bei einem abendlichen Festbankett die Aufmerksamkeit seiner Tischdame zu fesseln, berichtet er doch detailreich über einen Piratenschatz und die sich arabeskenhaft um den Schatz rankenden historischen Verwicklungen. Die Tischdame führt, in einer schmierenkomödiantisch dargebotenen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, das Profil einer idealen Rezipientin vor: nachsichtig gegenüber dem exaltierten Redestrom ihres brillierenden Sitznachbarn, gebildet und an den Freibeutern eigentlich weniger interessiert als an den saftigen Anekdoten und Details. Als aktive Zuhörerin sendet sie dem ‚stand-up-Essayisten’ jeweils Klarzeichen, damit er zwischen den Gängen des Festmahls sein verbales Feuerwerk fortsetzen kann; sie rundet die Erzählung mit einem anerkennenden Lächeln ab, das den Ich-Erzähler bestätigt und beglückt. Zuvor erfahren Tischdame und Lesende aber noch von dem fröhlichen Plagiat, das seinem Auftritt zugrundelag: Es handelt sich um die Abhandlung Om Sveriges planer och åtgärder rörande sjöröfvarne på Madagascar 1718-1727 von Hans Wachtmeister (Schwedens Pläne und Maßnahmen, die Seeräuber von Madagaskar betreffend, Universität Uppsala, 1848), von der bescheiden angemerkt wird, dass sie in vielen schwedischen Antiquariaten erhältlich sei. Diese belegbare Quelle [http://libris.kb.se/bib/2341463?vw=full] führt das ‚delectare et prodesse’ mustergültig vor, Akrobatik und Bodenhaftung miteinbegriffen. So spielt es auch keine Rolle mehr, ob die aus dem historischen Quellenmaterial herausgezurrten Anekdoten nicht doch mit Seemannsgarn verknotet sind.
Zitate sollten dem allt i allo-Schriftsteller (Künstler auf allen Gebieten) zufolge lieber elegant plagiiert als auf gelehrsame Weise nachgewiesen werden. Hier wird gleichsam unter der Flagge unbeschwerter Bildung, vor allem glücklicher Zufallsfunde und willkommener Überraschungen gesegelt.
Sjöberg zufolge ist jedes ausformulierte Essay das Kondensat eines vorgestellten Auftritts, und die Eitelkeit sei der Antrieb für die temporären Höchstleistungen. Der Erzähler gibt preis, dass er sich während des Schreibens vorstellt, auf einer Bühne zu stehen, alleine im Scheinwerferlicht, zum Publikum sprechend (vgl. S. 63). Der Selbstvergessenheit bei der Stoffsammlung steht damit die planvoll inszenierte und getimte Darbietung gegenüber, die sich des Leserinteresses auf schelmenhaft-verschlagene Weise immer wieder vergewissert, etwa durch kleine autobiographische Enthüllungen oder aber unerwartete Aktualisierungen: Ähnelt die an den König gestellte Forderung von Kapitän Spaak, eine Fregatte mit tausend Kanonen und freies Geleit zu erhalten, um den Piratenschatz bergen zu können, nicht dem Anliegen der heutzutage per Mail verschickten ‚Nigeriabriefe’?
Sjöbergs Genre ‚stand-up-Essay’ variiert das Fragment, da ausschnitthaft eine Zwischenbilanz des Kenntnisstandes geliefert wird, die zudem eng an eine autobiographische Phase gebunden ist. Die inszenierte Mündlichkeit sorgt sowohl für die dramaturgische Strukturierung als auch für eine selbstreflexiv wirksame Ironie, indem die – zu Umwegen bereiten – Leser durch das Dickicht der Querverweise und Abschweifungen („stickspår“) geführt werden:
„Dies passt nicht hierher, befürchte ich.“ – „Vielleicht ist es noch zu früh, dies hier anzubringen.“ – „Wir werden auf diesen Punkt später noch eingehen.“ Auch im Tempowechsel, hervorgerufen durch die alternierenden kurzen und längeren Sätze, drückt sich die paradoxe Spannung zwischen spontanen Eingebungen und planvollem Arrangement aus.
Weitere Motivationen für die inbrünstig verfolgten Seiten- und Nebenwege sind die autobiographischen Spiegelungen in den historischen Persönlichkeiten, seien es etwa der Literat Bengt Lidforss oder der Vogelmaler Lars Jonsson, die den egozentrischen Eklektizismus begründen, genau das in den Materialien zu finden, was man am liebsten behandeln möchte (vgl. S. 90). Vielleicht ist es, wie Sjöberg sagen würde, noch zu früh, dies jetzt schon zu verraten. Und dieser Filter ist zweifellos durch den Vergleich mit dem Lebensweg des Autors vorgegeben. Dabei geht er, im mehrfach erwähnten Austausch mit den Lesern, sogar darauf ein, dass ihm bei der Projektion des Eigenen auf das Fremde seine Bevorzugung männlicher Modell-Biographien bewusst sei: Unter Jungens funktioniere die Spiegelung eben besser („pojkar emellan“; S. 142). Wie ein Vorschlag zur Güte, gerade gegenüber den geneigten Leserinnen, stellt sich Sjöbergs Ankündigung dar, dass doch immerhin zwei Essays über die Journalistin Ester Blenda Nordström (1891-1948) und die im Geheimdienst beschäftigte Flohforscherin Miriam Rothschild (1908-2005) in Arbeit seien.
Die deutsche Leserschaft, der drei der vorausgegangenen Publikationen Sjöbergs, nämlich Flugfällan (2004; Die Fliegenfalle: Über das Glück der Versenkung in seltsame Passionen, 2010), Flyktkonsten (2006; Die Kunst zu fliehen, 2012) und Russinkungen (2009; Der Rosinenkönig, 2011) in der beeindruckenden Übersetzung von Paul Berf bekannt sind, darf damit rechnen, dass Sjöbergs Lieblingsreiseland Deutschland auch weiterhin die Essayproduktion anregen wird. Die eindringliche Erinnerung an den Vater (siehe das Essay „Pappa“) ist mit der intensiven Ortsbegehung von Rothenburg verknüpft, sowohl text- und bildbasiert als auch aus eigener, vielbewanderter Anschauung. Noch einmal tritt das Genre als ein Schmelztiegel von Kurzprosaformen hervor: die durchgestaltete Reportage, das autobiographisch angereicherte Portrait, das Paradestück en miniatur, die ausfransende Anekdote oder – wie im Text „Pappa“ – ein intimer Nachruf, in diesem Fall auf den Besitzer des Wagens, in dessen Seitentür sich der Autor einst als Kind spiegelte.
Doch nun ist es höchste Zeit, zu den sommerlichen Erlebnissen Ekelöfs zurückzukehren. Bedenkenlos die Diskursgrenzen überschreitend, stellt Sjöberg mit seinen Serendipitätsstudien unter Beweis, wie eine tiefbohrende fachwissenschaftliche Spezialisierung inzwischen fragwürdig erscheinen mag: Die Attitüde der Schreibenden und die Funktionalisierung des Empirischen legen jeweils im Voraus fest, unter welchen Prämissen überhaupt zu sammeln ist und wie zu dokumentieren und zu deuten ist. Dies pointiert beispielsweise ein kleiner Seitenhieb auf die positivistische Tradition innerhalb der schwedischen Literaturwissenschaft: „Han [Ekelöf] pallade äpplen – 27 år gammal! Plötsligt kände jag mig nästan som en litteraturforskare.“ (S. 93, ‚Ekelöf klaute Äpfel – mit 27 Jahren! Plötzlich kam ich mir fast wie ein Literaturwissenschaftler vor.’).
Dies hätte ich wohl an den Anfang meiner Besprechung stellen sollen: Die Frage im Titel „Warum macht man weiter?“ beantwortet sich selbst – im Prozess der Suche, des Hervortastens, des Skizzierens und Verwerfens. Trotz der mit Leichtigkeit daherkommenden Kunstfertigkeit von Sjöbergs Essays ist die Denk- und Stilfigur des Mäanders eine allgemeine Ermutigung zum ‚wilden Denken’. Deshalb liest man gerne weiter. Sieht dem nächsten objet trouvé mit großer Vorfreude entgegen. Und vielleicht hangelt man sich sogar nur zu gerne in seinen Arbeiten weiter, wie es uns Sjöberg vorführt. Varför håller du på?
Fredrik Sjöberg: Varför håller man på? och andra essäer. Stockholm: Bonniers, 2011.
(Antje Wischmann, Tübingen, Juni 2012)