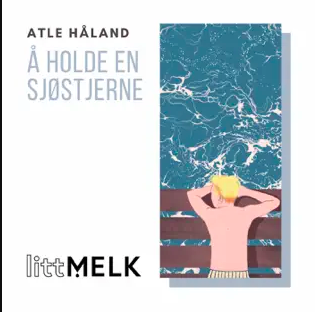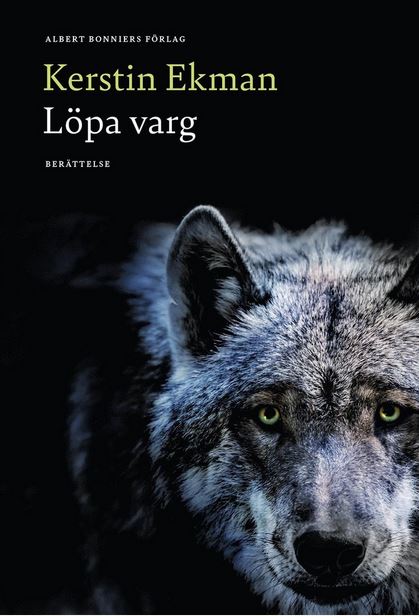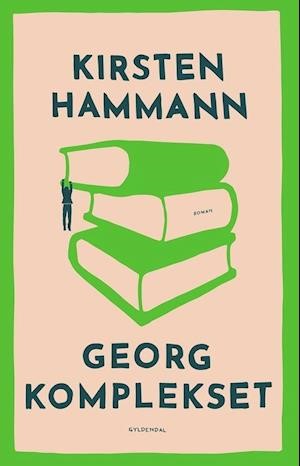Die Art, wie Literatur rezipiert wird, verändert sich. War bis vor einigen Jahren die Rezeption literarischer Texte noch eng mit dem gedruckten Buch verknüpft, erleben andere Formate aktuell einen markanten Aufschwung. Diesem wird nicht selten mit kulturpessimistischen Reaktionen begegnet. Waren es zunächst die E-Books, die das Diktum vom ‚Ende der Literatur‘ auf den Plan riefen, so ist es heute das seit Jahrzehnten etablierte Format Hörbuch, das aufgrund seiner neuen digitalen Verfügbarkeit in den letzten Jahren einen immer größeren Popularitätszuwachs verzeichnen konnte und gleichzeitig besorgte Kritiker*innen dazu veranlasste, den Niedergang der allgemeinen Lesekompetenz und den endgültigen Verlust jeglicher literarischer Qualität zu prophezeien. Fakt ist jedoch, dass der Trend zum Hören von Literatur in Audiobook-Form ungebrochen ist, auch in Skandinavien. Dort sind es vor allem die beliebten Streamingdienste im Abomodell, die den Vormarsch der akustisch vermittelten Texte vorantreiben.
Auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie das Hörbuch kann das Format Podcast zurückblicken. Auch wenn bereits in den 2000er Jahren eine erste Erfolgswelle der per RSS-Feed zu abonnierenden Sendungen über das Internet schwappte, wuchs deren Popularität im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts noch einmal kräftig an. Nahezu jedes vorstellbare Thema scheint mittlerweile von einem Podcast oder wenigstens von einzelnen Folgen der Internet-Sendereihen abgedeckt zu werden, und auch literarische Texte lassen sich in diesem Medium finden.
Nicht zu übersehen ist, dass das Sprechen über Literatur eine weitaus stärkere Stellung auf dem Podcast-Markt einnimmt als literarische Texte selbst. Ob von den etablierten Medienhäusern produziert oder von literaturinteressierten Laien, ob tiefgründige Analysen oder das Teilen persönlicher Leseerfahrungen: Im Netz finden sich vielfältige Schattierungen des Konzepts Literaturpodcast. Das Hauptaugenmerk liegt dabei augenscheinlich auf dem Präsentieren und Diskutieren verschiedenster Texte, seien es Neuerscheinungen oder Klassiker, und dem Informieren über oder Sprechen mit Schriftsteller*innen unterschiedlichster Etabliertheitsgrade. Derartige Formate entsprechen den gängigsten und beliebtesten Spielarten des Podcast-Mediums.
Im Gegensatz dazu scheint das Präsentieren literarischer Texte auf dem direkten Wege ein weitaus marginaleres Phänomen in der Welt der Podcasts zu sein. Die Ausnahmen verdienen allerdings eine nähere Betrachtung, weil sie nicht nur Rückschlüsse auf Literaturvermittlungsstrategien, sondern auch auf die medialen Spielregeln von Podcasts erlauben. Der norwegische Kolon forlag – podcast for ny litteratur (Verlag Kolon – Podcast für neue Literatur) stellt eine solche Ausnahme dar. Diese Sendereihe, die über alle herkömmlichen Plattformen zu beziehen ist, vermittelt Literaturinteressierten seit Ende 2019 in teils unregelmäßigen Abständen Textauszüge, die von den Autor*innen selbst gelesen werden, oder bietet Kostproben aus den Hörbuch-Versionen der Verlagstitel. An dieser Zusammensetzung lassen sich bereits unterschiedliche Zielsetzungen ablesen, die mit einem solchen Format vonseiten des Verlags verfolgt werden. Zum einen werden Informationen über Neuerscheinungen aus dem Verlagsprogramm automatisch an die Abonnierenden gesendet, und die bewusst ausgewählten Textausschnitte erfüllen eine ähnliche Funktion wie die klassische Leseprobe. Neben dem Bewerben der analogen oder digitalen Buchform wird zum anderen, im Falle der Hörbuch-Auszüge, für das akustisch vermittelte Format geworben. In jenen Fällen, in denen die Autor*innen selbst lesen, wird zusätzlich die vermeintliche (Ver-)Bindung des Publikums zu diesen gestärkt und im Sinne der Literaturvermittlung geschickt genutzt. Als eine Übergangsform zwischen autor*innenferner Literaturrezeption und dem multimodalen Erlebnis einer Autor*innenlesung wird das Interesse der Zuhörenden durch den Eindruck, die Schriftsteller*innen persönlich zu erleben, geweckt. Die Tatsache, dass die Darbietungsleistungen der Autor*innen manchmal hinter denen ausgebildeter Sprecher*innen zurückbleiben, wird durch die Nähe vermittelnde Ansprache der Zuhörer*innen ausgeglichen. Gleichzeitig verleiht das Trendmedium Podcast dem Verlag eine schicke, aber dennoch seriöse Aura.
Auffällig und gleichzeitig wenig überraschend ist, dass viele dieser literarischen Podcast-Formate Kinder der Covid-Pandemie zu sein scheinen. Während die Online-Sendungen im Allgemeinen in der Zeit sozialer Isolation nochmals massiv an Popularität gewannen, mussten viele Institutionen Wege finden, wie sie ihr Publikum durch Formen des asynchron-asyntopen Erlebens erreichen konnten. Wenige dieser Projekte hielten sich jedoch über die pandemische Hochphase hinaus; das Erscheinen neuer Folgen versiegte in vielen Fällen im Laufe der Jahre 2020 oder 2021. Litt. etwa, ein Podcast des norwegischen Verlags Oktober, operierte mit einem ähnlichen Konzept wie Kolon. »Her får du litt fra våre bøker rett på øret, lest av forfatterne selv« (Hier bekommst du ein bisschen was von unseren Büchern direkt ins Ohr, gelesen von den Autor*innen selbst) heißt es in der Beschreibung, die damit auf die doppelte Bedeutung von litt als Kurzform für ‚litteratur‘ oder im Sinne von ‚ein bisschen‘ hindeutet. Zwischen November 2020 und Juli 2021 wurden insgesamt 13 Folgen publiziert, die die Zehn-Minuten-Marke nicht überschreiten und jeweils kurze Textausschnitte aus den Neuerscheinungen des Verlags darbieten. Manche werden mit einer knappen inhaltlich-thematischen Zusammenfassung des Texts eingeleitet, andere stehen für sich. Doch die letzten Folgen deuten bereits auf ein abnehmendes Interesse vonseiten der Produzent*innen hin: Zwei der vier Episoden aus dem Juli 2021 sind fehlerhaft und nur wenige Sekunden lang, die anderen beiden weisen nur noch eine Länge von ein bis zwei Minuten auf und wurden ohne Intro produziert. Die Vermutung liegt nahe, dass dieses Format – literarische Texte, in Auszügen eingelesen – nicht die gewünschten Effekte als Marketinginstrument mit sich brachte. Gestärkt wird diese Annahme durch die Tatsache, dass derselbe Verlag im Mai 2021 mit einer neuen Podcast-Serie antrat: Akkurat dette, akkurat nå setzt wiederum auf das beliebte dialogische Sprechen über Literatur, das der prominente Chefredakteur des Verlags, Geir Gulliksen, gleich selbst in die Hand nimmt.
Haben literarische Texte also keine Chance im Medium Podcast? Mag sein, dass das Hörbuch-Streaming die Domäne der Texte bleibt, während Hintergründe, Interpretationsansätze und literarische Debatten von den leicht zugänglichen Sendereihen abgedeckt werden. Die Antwort darauf wird immer auch von den Hörgewohnheiten des Publikums abhängen, gleichzeitig tut die technische Seite des Podcast-Streamings ihr Übriges: Dadurch, dass die einzelnen Folgen automatisch nacheinander abgespielt werden und Podcasts häufig neben dem Ausführen anderer Tätigkeiten rezipiert werden, führt das rasche Aufeinanderfolgen von nicht kontextualisierten Texthäppchen mitunter zu verwirrenden, gar unangenehmen Hörerlebnissen.
Womöglich verläuft die Trennlinie aber nicht zwischen den verschiedenen Medienformaten, sondern zwischen den
unterschiedlichen Zielsetzungen und daraus resultierenden Herangehensweisen: Marketing auf der einen Seite und Textzentriertheit samt Hörer*innen-Orientierung auf der anderen. Die Sendung Lyden av MELK (Der Klang von MELK), die zwischen März 2020 und Dezember 2021 vom norwegischen Mikroverlag littMELK bespielt wurde, sendete in zwei ihrer drei Staffeln Texte, die entweder für die queere Kulturzeitschrift MELK oder für den Podcast verfasst worden waren und jeweils von den Autor*innen selbst eingelesen wurden. Die somit nicht primär auf den Verkauf von (Hör-)Büchern ausgelegten Episoden sind überdies qualitätsvoll produziert und mitunter aufwändig gestaltet, wie im Falle eines vertonten Gedichts und eines Kurzhörspiels. Im Sendungs-Teaser deutet die MELK-Mitgründerin Martine Næss Johansen diese hörer*innenorientierte Ausrichtung bereits an: »Hei! Så fint at du vil ha MELK i øret. […] Grunnen til at vi legger ut disse lydopptakene nå er at vi vil gjøre dem mer tilgjengelig for deg som lytter. Du fortjener å høre godt skrevne skeive narrativ. Du fortjener å høre dine egne historier […].« (Hallo! Schön, dass du MELK [dt. ‚Milch‘] im Ohr haben möchtest. […] Der Grund, warum wir diese Aufnahmen jetzt veröffentlichen, ist, dass wir sie für dich als Hörer*in zugänglicher machen wollen. Du verdienst es, gut geschriebene queere Narrative zu hören. Du verdienst es, deine eigenen Geschichten zu hören […]). Auch wenn die gut gemachten Folgen von Lyden av MELK, die vollständige Texte vermitteln und stimmige Musikelemente enthalten, genussvolles Literaturhören ermöglichen: Selbst dieses Format fand nach 16 Folgen sein Ende.
Literatur in Podcastform bleibt insgesamt ein Randphänomen, auch experimentelle Formen wie Podcast-Romane scheinen in Skandinavien noch keine Ableger gefunden zu haben. Die kurze Laufzeit der Versuche vonseiten größerer und kleinerer Verlage, die Online-Sendungen als Plattform für literarische Texte zu nutzen, zeigen: Die Bedürfnisse von Podcast-Hörer*innen sind allem Anschein nach anders gelagert. Gleichzeitig handelt es sich um ein simpel zu bespielendes Medium, das – ganz ähnlich wie Books-on-Demand-Konzepte – allen für die Veröffentlichung eigener Texte offensteht und grundsätzlich unterschiedliche Formexperimente ermöglicht. Womöglich lassen sich in Zukunft neben Instagram-Romanen auch literarische Experimente auf Podcast-Basis beobachten.
(Jay Geier)