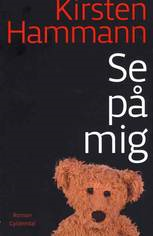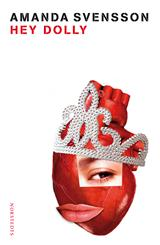 Anders lesen: Amanda Svenssons Pubertätsroman Hey Dolly (2008)
Anders lesen: Amanda Svenssons Pubertätsroman Hey Dolly (2008)
Als Dolly gefragt wird, mit welchem Lebensmittel sie sich am ehesten identifizieren könne, antwortet sie ohne Zögern: „En prinsesstårta. Jag skulle garanterat vara en prinsesstårta.“ Mit dieser Antwort sagt Dolly eigentlich alles: Die Torte mit ihrer vollen, runden Form, kalorienreich mit Sahne gefüllt und überzogen mit einer dicken Schicht süßen, schweren Marzipans soll Luxus, Überfluss und Ausnahme signifizieren; nach all dem sehnt sich Dolly: nach Glamour und Celebrity, Rausch und Ekstase. Und doch handelt es sich in beiden Fällen um ein Massenprodukt, ein Gebäck vom Fließband einer Konditoreifabrik und das Leben einer 19-Jährigen in Malmö.
In kurzen und ultrakurzen Abschnitten – vielleicht sind es Eintragungen in ein blog – erzählt Dolly ihre Geschichte: Sie ist schmutzig, voller Obszönität und Vulgarität. Für ihren Freund Mårten und seine Zufriedenheit mit einem Nullachtfünfzehn-Leben hat Dolly nur Verachtung übrig: Das Leben bietet ihm schon genug Befriedigung, wenn er nur Sex bekommt und den Nachmittag mit web-cam-Bildern aus dem Berliner Zoo vertrödeln kann. Ihm fehlt das Bewusstsein, dass ihm etwas fehlt. Als Dolly ihn „mit einem herrlichen Schwanz“ betrügt, beendet er die Beziehung. Als dann auch noch die labilen Freundinnen Emma und Katrin entweder in Alkoholismus oder Selbstmordversuchen vor die Hunde gehen, bricht auch bei der ach so coolen Dolly die ständig latente existentielle Krise aus. Zur Rettung kommt Marvin, ein alter Freund, 30 Jahre, abgebrochenes Psychologiestudium. Die von ihm aufgestellte Therapie umfasst folgendes Programm: Auf eine Kunstausstellung gehen, jemandem die Unschuld nehmen, etwas Schönes und Erbauliches für eine wahlfreie durchgeknallte Freundin tun, einen ganzen Tag seichten Pop hören, bis zum Erbrechen rauchen, sich einer lebensgefährlichen Situation aussetzen, einen wahlfreien ethnischen Konflikt analysieren, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ein Manifest schreiben und sich jeden Tag einem anregenden Gedankenspiel widmen. Und tatsächlich: In ihrem letzten Eintrag scheint Dolly wieder unter den Lebenden zu sein. Das Buch (oder das blog) endet in einem Weihnachtsgottesdienst mit den Worten: „Det är inte det att det inte är ett vackert liv. / Sartre och Mårten och alla andra depprövar kan go fuck themselves. Det finns ett ljus som aldrig brinner ut. En liten metallicficklampa i bröstet på varenda människa.“
* * *
Wäre Hey Dolly das Debut einer deutschen Autorin, würde es unter dem Label Popliteratur firmieren. Amanda Svensson baut ihre Figur aus Elementen der Popkultur zusammen: Dolly feiert die Künstlichkeit der Konsumwelt, zelebriert die Oberfläche, sie inszeniert sich als Echoraum des Populären in der Hoffnung, dass bereits das Nebeneinander, das Arrangieren von Bekanntem und Hundertmal-Gehörtem Sinn erzeugt – oder doch zumindest zu einer Attitüde von Sinn gerinnt. „Pop heißt Re-make und Re-model, heißt Zitat und Reproduktion, heißt Künstlichkeit und Übertreibung“, schreiben Kerstin Gleba und Eckhard Schumacher in ihrer Anthologie Pop seit 1964; und weiter: „Remix, Sampling, die Verarbeitung von vorgefundenem Material sind wichtiger als der originelle Einfall: das aufzuschreiben, was jetzt, in diesem Moment, passiert, ist wichtiger als die Haltbarkeit des Textes.“
Genau so muss man Hey Dolly lesen – als ein Surfen an der Oberfläche des Populären. Die Überschrift des ersten Kaptitels (oder des ersten blogg-Eintrags) führt dies mustergültig vor: „Will the real Dolly please stand up?“ Zitiert wird mit dieser Frage zunächst der amerikanische Rapper Eminem, der im Jahr 2000 einen HipHop Song mit dem Titel The Real Slim Shady herausbrachte, in dem die Zeile „Will the real Slim Shady please stand up?“ immer wieder wiederholt wird. Wie Dolly verstößt auch Eminem gegen jede political correctness und wie der Roman scheut auch das Video das Vulgäre nicht.
Mit der HipHop-Zeile zitiert Dolly aber einen Satz, der selbst bereits ein Zitat ist. Eminem übernimmt ihn aus der Episode „Will the Real Martian Please Stand Up?“ der amerikanischen Fernsehserie The Twilight Zone, die erstmals 1961 ausgestrahlt wurde, in der ein Überlandbus aufgrund starken Schneefalls im amerikanischen Nirgendwo zu einem Halt an einer Raststätte gezwungen ist. Schnell stellt sich heraus, dass einer der Passagiere ein getarnter Marsianer sein muss – doch das Geheimnis, wer der Mitreisenden es denn tatsächlich ist, wird erst am Ende gelüftet. Eingepasst in den Kontext von Hey Dolly wird das Zitat zu einem Hinweis auf Dollys Entfremdung. Wie der Marsianer passt sie nicht in Welt der Menschen.
Doch selbst mit diesem Bezug kommt die Kapitelüberschrift „Will the real Dolly please stand up?“ nicht an das Ende der Zitatkette. Denn The Twilight Zone hat den Episodentitel wiederum aus einer Spielshow übernommen. In To Tell the Truth (seit 1956 im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt) geben sich drei Kandidaten für dieselbe Person aus – etwa für John Smith; jeder versucht die Jury davon zu überzeugen, dass er das Original ist. Am Ende der Sendung bittet der Showmaster: „Will the real John Smith please stand up?“.
Allein die erste Kapitelüberschrift breitet also einen Zitatteppich aus, der das Sampeln, den Remix, das Zitieren von schon Zitiertem als wichtigste Strategie von Amanda Svenssons Roman offenlegt. Wer sich auf die Suche nach dem Ursprung eines Zitats macht, wird nur an ein weiteres Zitat verwiesen, wer nach metaphorischer Tiefe sucht, die zu einem Verständnis von Dollys Existenz führt, wird enttäuscht. Nein, Hey Dolly fordert ein anderes Lesen: eine metonymische Bewegung von einem Element zum nächsten, als eine Folge von Elementen, die nicht durch Ähnlichkeit des Wesens motiviert sind, sondern wie in dem Muster eines Teppichs von einem Ornament zum nächsten führt. Dolly ist ein Produkt der Unterhaltungsindustrie; nicht umsonst heißt sie nach einer ebenso künstlich produzierten „silikongefüllten Countrydiva“, die auch schon Namensgeberin für das Klonschaf Dolly wurde, dem einzigen überlebenden von 29 identischen Embrionen. Der Name selbst indiziert also Serialität und Künstlichkeit.
* * *
Wie liest sich auf der Basis dieser popkulturellen Einbettung das Happy End? Erlebt Dolly eine existentielle Krise, die sie zwingt, der Konsumwelt den Rücken zuzukehren, um dann in die Wirklichkeit und in ein authentisches Leben aufzubrechen? Sie selbst bietet an einer frühen Stelle ein solches Deutungsmuster an, wenn sie betont, dass sie das, was ihr gerade passiert als Wendepunkt erlebt: „Jag känner mej pånyttfödd. En katharsis“! Doch später, als wiederum ihre Freundin aus ihrem verkorksten Leben ausbricht, markiert Dolly das Modell der reinigenden Umkehr als unwirklich; es funktioniere nur in Romanen: „Hade jag läst det här [= der Aufbruch der Freundin in ein neues Leben] i en bok hade jag krävt en forklaring. Nåt slags katharsis. Men Emma fungerar inte så.“ Die Katharsis ist eine erzählerische Strategie, eine Logik, die man für Fiktionen akzeptiert, aber nicht etwa für das „wahre“ Leben.
Als sich Dolly neu verliebt, deutet sie an, dass sie nach der Logik des Populären nun über ihre Krise hinweggekommen sein müsste – „Om det här nu hade varit en fånig svensk ungdomsfilm om en tonårstjej med identitetsproblem, då hade de där problemen varit lösta nu.“ – was sie natürlich weit von sich weist. Doch passiert in Hey Dolly wirklich etwas anderes? Stößt uns Amanda Svensson mit der eben zitierten Stelle nicht vielmehr mit der Nase darauf, dass auch Dollys Lösungsweg – durch eine Reihe von absurden Aufgaben den Kontakt zum wahren Leben zu finden – ein Klischee ist, das wir alle schon hunderte Male im Vorabendprogramm, in soap operas und schlechten Jugendbüchern gesehen, gelesen, gehört haben? Aus dem Klon Dolly wird kein Individuum durch die Wiederholung eines Ritus, der ebenfalls populärkulturell codiert ist. Und so ist auch ihr letzter Satz, der ihre Rückkehr unter den Lebenden beweisen soll, – „Det finns ett ljus som aldrig brinner ut. En liten metallicficklampa i bröstet på varenda människa.“ – doch nur wieder ein Zitat. The Smiths wusste schon 1986: „There is a light that never goes out.“
Amanda Svensson: Hey Dolly. Norstedts, 2008.
(Joachim Schiedermair, Greifswald, Februar 2012)
P. S. Die schwedische Presse hat Hey Dolly durchgängig als einen Text gelesen, in dem die Generation der jetzt Zwanzig-Jährigen authentisch dargestellt wird, so dass Dolly ein positives Modell für junge LeserInnen darstellen könne; Svenska Dagbladet etwa hält Dolly für „en helt vanlig tonåring“, Hälsingborgs Dagblad spricht von einem „generationsroman“, der von „typiska tjugonånting problem“ handelt und Västerbottens-Kuriren unterstreicht „de generationsbetingade inslagen“. Nimmt man jedoch die Ironie wahr, die Dollys Krisenmanagement trägt, läge das Authentische des Buches nur in dem Nachweis völliger Authentizitätslosigkeit der Generation, der Dolly – und Amanda Svensson – angehören.