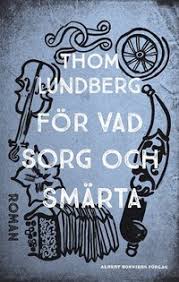 Wird Literatur einer identitätspolitischen Agenda zugeordnet, kann man mitunter den Eindruck gewinnen, diese Werke seien über jegliche Literaturkritik erhaben. Der politische Appell, sich gegen Diskriminierung und soziale Ungleichheit zu wenden, findet in den schwedischen literarischen Institutionen stets Gehör. Das Erstlingswerk För vad sorg och smärta von Thom Lundberg (geb. 1978) bietet grelles Provokationspotential − durch seinen archaisierenden Legendenstil, die vielen Einschübe in Romanes (d.h. der Sprache der Roma) und die holzschnittartigen Gewaltschilderungen, die an die Inhalte und Illustrationen historischer Bänkelsänge erinnern. Die Kritik setzte sich bisher aber fast ausschließlich mit der im Roman thematisierten Traumabearbeitung und dem folkhem-Rassismus auseinander. Das Gespräch, das der etablierte Schriftsteller Ola Larsmo auf der Buchmesse in Göteborg mit dem Autor führte (2.9.2016, https://urplay.se/program/200164-for-vad-sorg-och-smarta), veranschaulicht den Respekt, mit dem man Lundbergs Debütwerk begegnete. Tatsächlich ist festzustellen, dass Lundberg einer Minoritätsgruppe ermöglicht, in der literarischen Repräsentation anzukommen.
Wird Literatur einer identitätspolitischen Agenda zugeordnet, kann man mitunter den Eindruck gewinnen, diese Werke seien über jegliche Literaturkritik erhaben. Der politische Appell, sich gegen Diskriminierung und soziale Ungleichheit zu wenden, findet in den schwedischen literarischen Institutionen stets Gehör. Das Erstlingswerk För vad sorg och smärta von Thom Lundberg (geb. 1978) bietet grelles Provokationspotential − durch seinen archaisierenden Legendenstil, die vielen Einschübe in Romanes (d.h. der Sprache der Roma) und die holzschnittartigen Gewaltschilderungen, die an die Inhalte und Illustrationen historischer Bänkelsänge erinnern. Die Kritik setzte sich bisher aber fast ausschließlich mit der im Roman thematisierten Traumabearbeitung und dem folkhem-Rassismus auseinander. Das Gespräch, das der etablierte Schriftsteller Ola Larsmo auf der Buchmesse in Göteborg mit dem Autor führte (2.9.2016, https://urplay.se/program/200164-for-vad-sorg-och-smarta), veranschaulicht den Respekt, mit dem man Lundbergs Debütwerk begegnete. Tatsächlich ist festzustellen, dass Lundberg einer Minoritätsgruppe ermöglicht, in der literarischen Repräsentation anzukommen.
Die Handlung des Romans besteht aus der tragischen bis melodramatischen Geschichte der Familie Klosterman, die mit pogromähnlichen antiziganistischen Ausschreitungen in Jönköping 1948 konfrontiert ist und diese zum Anlass für ihre fluchtähnliche Übersiedlung nach Halland nimmt. Der Vater Amandus, ehemaliges Roma-Waisenkind, wurde einst von einem Schweden als Pflegekind aufgenommen. Wegen seiner uneindeutigen Herkunft kämpft er gegen eine ethnische Skepsis innerhalb der Familie. Sein wenig erfolgreicher Verkauf von Metallwaren auf ländlichen Marktfesten und sein Alkoholismus führen dazu, dass seine Frau Severina und seine drei Kinder Olof, Valentin und Syster in bitterer Armut leben müssen. Für den anpassungsbereiten Olof und den impulsiven Valentin ist der gesellschaftliche Abstieg des Vaters quälend. Die patrilineare Tradierung ist am Ende des Romans völlig zerstört: Unterdrückung und Exklusion der Romagruppen entfachen gewalttätige Konflikte zwischen den Familien, aber auch mit der abweisenden Lokalbevölkerung. Die Diskriminierung führt wörtlich und metaphorisch zu Deformationen und entfesselt im Falle Valentins unbändige Aggression, auch gegen sich selbst. Die Messerstechereien zielen auf Rache gegenüber den Peinigern ab und zeichnen ein groteskes Bild eines Ehrenkodex. Die jeweiligen Unterdrücker bzw. zu feindlichen Repräsentanten erkorenen Personen werden in ihrer konkreten Handlungsmacht ‚kastriert‘, wobei das Abtrennen von Fingern hier die konkrete Ausdrucksform eines vererbten familiären Traumas bildet: Amandus wurde einst gezwungen, eine solche Verstümmelung vorzunehmen, und er setzt seinen Sohn Olof eines Tages unter Druck, diese Tat ebenfalls zu begehen, was zu dessen Traumatisierung führt.
Nachdem Severinas Bruder dem unwürdigen Amandus einen kunst-geschmiedeten Familienschrein gestohlen hat, der symbolisch für den sorgfältig gepflegten Erinnerungsschatz an Legenden, Erzählungen, Liedern und Balladen steht, eskaliert die Spirale der Gewalt. Olof, zusätzlich von Valentin in einer Schlägerei öffentlich gedemütigt, reagiert sich an seinem Onkel ab und fügt ihm Schnitte im Gesicht zu. Die wiederholt verwendete Formel „Din hand är allas hand“ („Deine Hand ist unser aller Hand“) erscheint absurd konterkariert, denn nun attackieren sich sogar die Mitglieder der Gemeinschaft gegenseitig bis auf den Tod („På mitt liv och min kniv“, S. 27; ungefähr: „auf mein Leben und mein Messer“). Valentin, der nicht wie Olof einer Phase sozialer Mobilität erlebt, sondern nach kurzer Kindheit routinemäßig Händel sucht und dem unerreichbaren Traum von einem Autokauf nachhängt, nimmt am Ende des Romans die Gelegenheit wahr, sich an einem Mobbingtäter aus der Kindheit zu rächen. Olof kann nicht verhindern, dass Valentin auch dessen Hand verstümmelt. Die letzte Szene des Romans stellt dar, wie Olof sich entscheidet, das Verbrechen auf sich zu nehmen und sich zu stellen, damit Valentin fliehen und ein neues Leben beginnen kann. Während Sturm aufzieht und der dunkelblaue Himmel sich – wie so oft im Roman – schwarz färbt, wartet Olof am Strand auf seine Häscher. Ob er mit dem Leben davonkommt und ob Valentins Flucht gelingt, bleibt dabei offen.
Die Mutter Severina stammt aus einer norwegischen Romafamilie, die vom sagenumwobenen Großvater Fingal und der Großmutter mit dem sprechenden Namen Eufrosyne (Pseudonym der schwedischen Dichterin Juliana Nyberg 1785-1845) angeführt wird. Severina ist Urheberin des titelgebenden Lieds mit zahlreichen Strophen, das sie mehrmals anstimmt, aber nie abschließt. Zu Beginn der 1940er Jahre wurde sie von der schwedischen Sozialbehörde für unmündig erklärt und zwangssterilisiert, ihre Tochter Syster wurde einer schwedischen Pflegefamilie übergeben. Der Pflegevater, ein Pfarrer, sowie der sozialdemokratisch profilierte Arzt, der Olofs Verletzungen behandelt, werden als wohlmeinende Vertreter des folkhem gezeichnet, so dass auch die besten Absichten der schwedischen Modernisierer Berücksichtigung finden.
Olof bekommt vom Arzt Onkel Toms Hütte geschenkt und stellt bei der Lektüre fest, dass es in diesem Werk doch eigentlich um Roma ginge (vgl. S. 260). Amandus wiederum macht durch die Begegnung mit einem lesenden Nachbarn aus dem Lumpenproletariat indirekt die Bekanntschaft mit dem Statare-Genre und fragt sich gemeinsam mit Severina, ob in diesen Texten eigentlich auch „romanoa“ (eine Selbstbezeichnung für Romagruppen) als literarische Figuren vertreten seien (vgl. S. 146). Olof hätte die Chance gehabt, durch Bildung oder die Verlobung mit der Arzttochter bis ins Kleinbürgertum aufzusteigen. Armut und unregelmäßiger Schulbesuch, aber auch die Dekadenz des Vaters und die psychische Krankheit der Mutter verhindern dies.
Severina stirbt früh an Tuberkulose, aber die matrilineare Tradierung von Liedtexten und Gesängen wirkt noch über ihren Tod hinaus weiter. Gemeinsam mit Olof hat sie eine letzte Strophe für das titelgebende Lied erfunden, so dass Olof als Identifikationsfigur des Autors erscheint. Die metaphorische Umschreibung des Sterbens im Schwedischen, dass man ‚den letzten Vers singe‘, bestätigt trotz der sagenhaften Überlebensfähigkeit der Erzählungen zugleich eine Verabschiedung von einer prämodernen Lebensweise.
För vad sorg och smärta verfolgt auch eine Revitalisierung von Romanes bzw. „romani chib“ – die Selbst- und Fremdbezeichnungen der Varietäten sind bekanntlich umstritten, wobei die Nationalsprachen Schwedisch (für die väterliche Linie) und Norwegisch (für die mütterliche Linie) im Roman als Koordinaten aus den Majoritätssprachen herangezogen werden. „Romani chib“ zählt zu den fünf offiziellen schwedischen Minoritätssprachen (siehe http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/romska.html). Lundberg bindet Romanes-Wörter und Wendungen in den schwedischen Text ein und entwickelt eine ethnographisch fundierte Kunstsprache, verzichtet jedoch auf ein Glossar oder Fußnoten. Überwiegend wird kurz vor oder gleich nach einer solchen mehrsprachigen Einheit ein schwedisches Synonym geliefert oder eine klärende Kontextualisierung gewählt. Die Lesenden stehen anfangs vor einer gewissen Herausforderung, machen aber bei der Lektüre rasch Fortschritte, da in bestimmten Passagen einige Begriffe gehäuft auftauchen oder sich semantische Felder erschließen lassen. Hat man die ersten beiden der insgesamt sieben Teile einigermaßen sorgfältig gelesen, werden Herleitungen möglich. Auch haben sich bestimmte Schlüsselbegriffe während der Lektüre durch ihre hohe Frequenz eingeprägt, wie etwa tjavo (junger Mann), nukko (Junge), dikkla (besticktes Tuch der Frauen), tjuring (Messer der Männer), drom (Landstraße in der Nähe der Siedlung), honka (sein; scheinen), rakkla (sich unterhalten), penna (verstehen; sagen, erklären), tradra (gehen), bengalo (betrunken; verrückt) sowie der Ausruf des Erstaunens „Develska dad!“.
Während wir beim Lesen in ein Universum aus Viehmärkten, Pferdegespannen, Taschenuhren und Schnurrbärten versetzt werden, verfolgt der Autor das Anliegen, sowohl verschiedene – meist regional, landschaftlich oder über Helden mythischen Formats bestimmte – Romagruppen, Romanes-Varietäten als auch unterschiedliche Grade der Sprachbeherrschung und den individuellen Alltagsgebrauch zu repräsentieren. Da die Absicht der Repräsentation markiert bleibt, erscheint bei Lundberg die dargestellte Heteroglossie weniger der Mimesis verpflichtet, als es gemeinhin minoritätssprachlichen Passagen in literarischen Werken nachgesagt wird, die in Majoritätssprachen verfasst sind. Die kompositorische Grundstruktur als Klagegesang oder kolportierte Legende mit den Erzählmustern von Steigerung und Überbietung, die literarischen Kleinformen entlehnt sind, unterläuft die klassische Authentizitätsvergewisserung und das Anliegen einer Dokumentation historischen Sprachgebrauchs.
För vad sorg och smärta ist ein Pionierwerk, das erklärtermaßen einen Standard für eine schriftliche Varietät von Schwedisch-Romanes festlegen will (vgl. Nachwort, S. 364) und damit nicht weniger als eine Literatursprache Romanes erprobt. Vermutlich ist dem Werk daher in der Tat ein Platz in der schwedischen und vielleicht auch in der transkulturellen Literatur sicher.
„Carl och Maximilian rakklade på övervägande romani. Detta honkade Olof tji van vid, för i hans uppväxt hade han mest hört svenska med romaniinslag, men nästan aldrig romani med inslag av svenska. Och aldrig ren romani.
Maximilian pennade till Carl: „Glaneske nukkon avar, tjakkes mandrom mostula bescha nevroa daxa prej hakket.“
„Develske dad! Honkar diro romni pari?“ frågade Carl.
„Ashi, miro phral! Li ashar nevreske-pari.“
„Vorsnos nukkoar ashar vorsnos sass“, pennade Carl.
„Dolle honkar sosti vorsnos sastot tradrar prej romano-dromen“, pennade Maximilian.
Olof försökte följa med i samtalet. Kanske om han nickade på något ställe? Eller såg intresserad ut när Maximilian rakklade. Han hade lärt sig hur Carls ansikte såg ut precis innan han kom till slutklämmen på en rolig historia och på detta vis förstod han när han skulla skratta. Snart övergick samtalet till övervägande svenska, för både Maximilian och Carl kände sig tryggare att rakkla på detta mål.“ (S. 234)
[Carl und Maximilian unterhielten sich fast durchgehend in Romanes. Dies war Olof offensichtlich nicht gewohnt, denn während seiner Kindheit hatte er meistens Schwedisch mit Romanes-Einschlag gehört, aber fast nie Romanes mit schwedischem Einschlag. Reines Romanes kannte er gar nicht.
Maximilian erklärte Carl: „Glaneske nukkon avar, tjakkes mandrom mostula bescha nevroa daxa prej hakket.“
„Develske dad! Honkar diro romni pari?“ fragte Carl.
„Ashi, miro phral! Li ashar nevreske-pari.“
„Vorsnos nukkoar ashar vorsnos sass“, erklärte Carl.
„Dolle honkar sosti vorsnos sastot tradra prej romano-dromen“, erklärte Maximilian.
Olof versuchte dem Gespräch zu folgen. Vielleicht sollte er ab und zu nicken? Oder interessiert schauen, wenn Maximilian erzählte. Er hatte schon gelernt, wie Carls Gesicht aussah, wenn er bei der Pointe einer lustigen Geschichte angekommen war, und daher war ihm klar, wann er lachen musste. Bald ging das Gespräch mehr und mehr ins Schwedische über, denn sowohl Maximilian als auch Carl fühlten sich sicherer, wenn sie in dieser Sprache redeten.]
Mittels dieser Passage werden nicht nur Nuancierungen eingeführt, die anschaulich von monolingualen Kategorisierungen wegführen, sondern auch eine ironisch anmutende Distanzierung ermöglicht: Ein durchgehender Dialog auf Romanes wird als Imponiergehabe von Halbstarken relativiert und das Konstrukt „reines Romanes“ vorausschauend in Frage gestellt, beinahe wie um Analogien zu Nationalsprachen oder naive Sprachutopien im Vorfeld auszuschließen, die sich im Zuge einer Romanes-Revitalisierung womöglich ergeben könnten. Indem eingeräumt wird, dass mehrere Varietäten bereits um 1950 selten verwendet wurden, verbinden sich die Geschichte vom Verfall einer Familie mit der Beobachtung eines Sprachverlusts in der Diaspora. Die historische Rückverlegung der Handlung täuscht allerdings über den Domänenverlust der Varietäten hinweg und klammert damit das Thema der Sprachentwicklung im Zeichen gesellschaftlicher und technisch-medialer Modernisierung aus.
Das Kalkül einer angemessenen Progression beim Spracherwerb während der Lektüre geht also fast vollständig auf, nur wenige Zeilen bleiben unverständlich. Die Formen der Deklination und Konjugation sind interessanterweise analog zum Schwedischen gebildet (tjuringen, nukkoar oder rakklade), auch die Syntax wird beibehalten, womit der Autor ein bewährtes Verfahren aus mehrsprachigen Werken einsetzt und die exotischen Elemente auf den Wortschatz (Lexik) konzentriert. Im Internet lassen sich nur wenige Wendungen finden, der erste Treffer ist ohnehin meist die Google-Book-Version des Romans – nicht weiter verwunderlich, da Lundberg einige Schreibformen mündlicher Ausdrücke tatsächlich erst neu eingeführt hat. Bezeichnenderweise leiten die eingegebenen Wörter aber auch zu Homepages von Interessengruppen oder Privatpersonen, die sich der släktforskning (Familienforschung) widmen, auf die auch Lundberg bei seinen Vorarbeiten zurückgegriffen hat.
Maßgebliches Kriterium für die Zugehörigkeit zu einer Romagruppe ist weniger der gemeinschaftsstiftende Sprachgebrauch, sondern eine ethnische Selbstdefinition. Die Rekonstruktion des im Roman leitmotivisch vom Erzähler und den Figuren genannten „ursprung“ wird somit als identitätspolitische Notwendigkeit dargeboten. Die Möglichkeit einer Selbstzuschreibung oder eines Beitritts zur Community, die sich nicht über den Ursprung herleitet, scheint kaum gegeben. Vor diesem Hintergrund betrachtet ist die historische Schwerpunktsetzung des Werks etwas problematisch: Indem der Roman seine Handlung explizit auf einen historischen Zeitraum begrenzt (1949−1955), stellt sich die Frage, ob die zahlreichen Kommentare des meist auktorialen Erzählers zum Recht der Romagruppen auf eine eigene, sowohl biographische als auch gruppenspezifische und kollektive „Erzählung“ zu sehr damaligen Denkfiguren verpflichtet bleiben. Die Einschübe in Romanes und das ornamenthafte Sprechen in Zitaten oder Sprichwörtern führen dazu, dass För vad sorg och smärta inhaltlich und stilistisch Anachronismen pflegt, was beispielsweise die Kritik am Machismo abzuschwächen droht. Der historistische Gestus ist durchaus beabsichtigt, denn im Nachwort teilt Lundberg mit, welche Literatur aus den 1930er und 1940er Jahren er zitiert und paraphrasiert hat (vgl. S. 363), und fügt die aufschlussreiche Bemerkung hinzu, dass sein Roman in eben diesen Jahrzehnten hätte erscheinen sollen. Damit gibt sich das Werk als nachträglich verfasste Emanzipationserzählung, ganz im Sinne eines Pastiches der berühmten Statare-Romane (von u.a. Harry und Moa Martinson, Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson). Lundberg liefert also einen literaturgeschichtlichen Beitrag nach, der zudem eine Rückverlängerung und Kontinuitätsvergewisserung der Kulturgeschichte skandinavischer Romagruppen leisten soll. Der Erzähler, dessen Legendenüberblicke oft die Kapitel einleiten, verwendet parallel zum historischen Vokabular aber auch neuzeitliche Begriffe wie „Mobilität“ oder „Initiation“, d.h. die Geschichtsrückverlängerung soll im Erscheinungsjahr 2016 einsetzen: „att leva i nuet är att återberätta det förflutna“ („in der Gegenwart zu leben bedeutet, die Vergangenheit zu erzählen“, S. 19). Lundberg setzt dabei auf eine starke Autorschaft. Die historistisch-ethnographische Vorgehensweise bei der schöpferischen Sprachrekonstruktion und der mal feierlichen, mal übermütigen Inszenierung des Erzählschatzes bietet fließende Übergänge zum Folkloristischen. Die Gefahr des Ethnokitsches wird jedoch durch die grotesken Gewaltschilderungen, die hyperbolische Rhetorik und den ironisierten Selbstexotismus einiger Figuren gebannt.
För vad sorg och smärta stellt einen wichtigen Beitrag zum Thema „utanförskap“ (Exklusion) dar, das gerade im Erscheinungsjahr des Romans in der schwedischen Öffentlichkeit breit diskutiert wurde. Die historische Einkapselung durch den recherchebedingten Fokus auf die Jahre um 1950 lässt die Handlung museal erscheinen, auch wenn diese durch die variantenreichen Anekdoten und das eingearbeitete mündliche Literaturkorpus als historistisch ausgewiesen ist. Das Niedergangsnarrativ und der Appell zur minderheitensprachlichen Revitalisierung stehen dabei in einem ungelösten Spannungsverhältnis. Wird Romanes in einer schriftlichen Standardvarietät benötigt, um eine zukunftsweisende Literatursprache für die fortzusetzende, existenziell wichtige Erzählung – auch der zur Repräsentation der „romanoa“ dienenden Erzählungen – zu etablieren? Soll eine Varietät, womöglich die angeblich älteste nordische Romanes-Varietät standardisiert und zum Leitstern dieser Literatursprache werden? Der Status als Kunstsprache müsste von Rezensenten und Forschenden sehr viel stärker herausgestellt werden – hier sollte man von der Debatte lernen, die über Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött (Kamel ohne Höcker, 2003) und die angebliche Verwendung des „rinkebysvenska“ geführt wurde (seine Literatursprache wurde irrigerweise als migrantischer Soziolekt eines Stockholmer Vororts eingeordnet). Möglicherweise lösen Werke wie diese, die als literarische Ausdrucksformen der Glokalisierung gelten können, in der ersten Rezeptionsphase das Bedürfnis aus, vergewissernde Re-Territorialisierungen anzuleiten. Indem die Gebiete, in denen die Varietäten von Romanes bzw. romani chib einst verbreitet waren oder es heute noch sind, in För vad sorg och smärta geographisch oder landschaftlich bestimmt werden, entsteht immerhin eine Art Sprachkarte über die betreffenden skandinavischen Regionen.
Lundberg liefert eine Gegenerzählung aus der Perspektive der Subalternen nach. Indem die geschilderten Romagruppen schon in der Anfangszeit des schwedischen folkhem aus der gesellschaftlichen, sozialen, politischen und technischen Modernisierung sowie aus dem Bildungsprojekt – als Schlüssel für den Aufstieg breiter Bevölkerungsschichten – nachdrücklich ausgeschlossen wurden, schien deren Partizipation für Jahrzehnte verhindert, mit Folgen bis heute. Lundbergs Roman spitzt den Handlungsverlauf auf sechs katastrophale Jahre zu, die deutlich von der Rassenhygiene und dem Holocaust geprägt sind, stellt aber nur in den neuzeitlichen Begriffen der Erzählerkommentare überhaupt einen Bezug zu heutigen Lesenden her. Ist der historische Stoff brisanter als die aktuelle drastische soziale Ungleichheit oder andere, zugegebenermaßen unübersichtlichere Konfliktfelder? Zunächst einmal ist wohl ein wichtiges Teilziel erreicht, die literarische Repräsentation mit der Vision einer politischen Repräsentanz. Lundbergs Experiment, den Handlungsverlauf mit einer Sprach(re)vitalisierung während der Lektüre zu verknüpfen, ist ebenfalls bemerkenswert.
Thom Lundberg: För vad sorg och smärta. Bonniers: Stockholm, 2016.
(Antje Wischmann, Wien)









