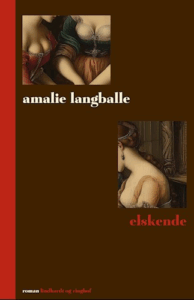Eine Hofdame am königlichen Hof wird während eines hitzegesättigten Sommers, in dem die Pest in der Hauptstadt wütet, von ihrem Ehemann zum Arbeiten in das erste Bordell am Platz geschickt. Soll dies ihrer Unfruchtbarkeit abhelfen (auch wenn „sæd i spandevis“ [eimerweise Samen] (S. 196) sie nicht schwängern werden)? Oder ist dies die Strafe dafür, dass sie ihren Ehemann langweilt „så grumt som en gammel sæk kartofler“ [so grausam wie ein Sack Kartoffeln] (S. 19)? Oder ist der Ehemann schlicht vom Wahnsinn am Hof angesteckt worden, der in diesem Pestsommer „lå på lur i et randområde af ens bevidsthed som en kobbel af hurtige hunde, sultne og tørstige“ [im Randbereich des Bewusstseins wie eine Koppel flinker Hunde, hungrig und durstig, auf Lauer lag] (S. 9)?
Im Bordell wird die Hofdame, die als namenlose Ich-Erzählerin die Geschehnisse des Sommers berichtet, vertraut gemacht mit allen Spielarten sexueller Praktiken, mit Gerüchen, Schweiß und Körpersekreten jeder Art. Betrieben wird das Bordell von der rätselhaften Viola, die sich im Laufe der lange zweisträngig entfalteten Handlung als frühere Geliebte der Frau des Königs zur linken Hand, Sunniva, entpuppt. Als Bordellmutter versucht Viola, genügend Geld zusammenzubringen, um mit Sunniva in den Süden fliehen zu können. Doch muss Viola am Ende des Romans alleine des Weges ziehen, weil Sunniva sich in letzter Sekunde entscheidet, beim König zu bleiben. Zuvor hatte Sunniva versucht, die Hure Gunhild, die vom König schwanger geworden ist, umzubringen. Nach dem Tod von Gunhild als Spätfolge des Anschlags ertränkt die Ich-Erzählerin deren Baby im Moor, bevor sie schließlich am Ende des Sommers von ihrem Mann zurückgeholt wird.
Autofiktionalität und Maskenspiel
Die Autorin dieses Überraschungserfolgs im dänischen Buchsommer 2025 heißt Amalie Langballe. Ausgebildet als Journalistin, ist sie derzeit bei der Wochenzeitung Weekendavisen als Literatur- und Theaterrezensentin tätig. Debütiert hatte Langballe 2019 mit Forsvindningsnumre (Nummern des Verschwindens), ein mit dem dänischen Debütant:innenpreis ausgezeichnetes Buch über die Trauerarbeit einer jungen Frau, nachdem die Mutter nach langer Krankheit an Krebs gestorben war. Langballe machte keinen Hehl aus der Nähe des Stoffes zu ihrer eigenen Biographie. Sie beharrte indes darauf, dass das Buch Fiktion sei,1 obwohl das dänische Feuilleton es – vorhersehbar – im Horizont autofiktionaler Werke situierte.
Mit elskende [Liebende] legt Langballe nun nach sechs langen Jahren ihren zweiten Roman vor, der sich geradezu demonstrativ allen Einordnungsversuchen in das Genre des Autofiktionalen verweigert. Man mag ihn gar, ist er doch von einer aktiven Literaturrezensentin geschrieben, metapoetologisch als eine Kritik an der Poetik der Autofiktion lesen, die in Dänemark zunehmend kritisch reflektiert wird. Erst unlängst warf Lotte Folke, Redakteurin bei der dänischen Tageszeitung Politiken, autofiktionalen Werken Kritikimmunisierung vor: Einerseits werde eingefordert, dass die Kritik sich nicht zum Richter über die persönlichen Wahrheiten anderer machen dürfe, andererseits werde die Literarizität der Werke in Anspruch genommen, um alles sagen zu können.2
elskende mag bei den dänischen Lesenden mit seinen ausführlichen, in Rezensionen vielerwähnten drastischen Sexszenen manche provokativen öffentlichen Einlassungen der Autorin aufrufen. In der überschaubaren dänischen Kulturszene ist Langballe nicht zuletzt für ihr nicht mit Scham behaftetes Reden über die eigene Sexualität und Körperlichkeit (einschließlich ihrer Entscheidung für eine frühe Sterilisation), für ihren Einspruch gegen slutshaming und für ihr Eintreten für Sexpositivität bekannt. In PR-Bildern lässt sie sich durchaus auch im Unterhemd ablichten. Eine durch Autofiktionalität geprägte Erwartungshaltung unterläuft der Roman aber geschickt in vielfältiger Weise.
In einer Art metafiktionaler Vorrede wird der Diskurs des Autofiktionalen zwar indirekt zu Beginn des Romans noch aufgerufen (wenn auch in zeitgenössischer Verkleidung einer Beichte, in der die Hauptperson versucht, sich Rechenschaft über die Geschehnisse des Sommers abzulegen), zugleich aber wird die Fragmentarizität und Fiktionalität des im Folgenden Erzählten nachdrücklich unterstrichen:
Min historie kommer ikke til at give mening. Uanset hvordan jeg anstrenger min erindring, glider mig noget af hænde, og andet kan jeg ikke få placeret. Jeg kan genkalde mig billeder uden sammenhæng: sort røg, en hests svedige flanker, høstmånen.
Der er ting, jeg ved med sikkerhed, men der er flere ting, jeg ikke ved overhovedet. Det er muligt, at drøm og virkelighed har vævet sig ind i hinanden. En tråd af virkelighed har muligvis lagt sig oven på en tråd af drøm, og selv i optrevlingen kan den ene tråd ikke skelnes fra den anden. (S. 7)
[Meine Geschichte wird keinen Sinn ergeben. Egal, wie sehr ich meine Erinnerung anstrenge, entgeht mir etwas, und anderes kann ich nicht einordnen. Ich kann Bilder ohne Zusammenhang aufrufen: schwarzer Rauch, die verschwitzten Flanken eines Pferdes, der Herbstmond.
Es gibt Dinge, die ich mit Sicherheit weiß, aber es gibt noch mehr Dinge, die ich überhaupt nicht weiß. Möglicherweise haben sich Traum und Wirklichkeit miteinander verflochten. Ein Faden der Wirklichkeit hat sich womöglich über einen Faden des Traums gelegt, und selbst beim Entwirren lässt sich der eine Faden nicht vom anderen unterscheiden.]
Im Gewebe des Textes ist etwas Neues, eine fiktive Welt jenseits der Dichotomie von Traum und Wirklichkeit entstanden, etwas, was den Lesenden nur in Fragmentform zugänglich ist. Formal findet dies seinen Ausdruck in den knappen, zumeist nur ein- bis zweiseitigen Textpassagen, aus denen der schmale Roman besteht. Die Fiktivität der Romanwelt wird zudem durch die zeitliche und räumliche Situierung des Geschehens unterstrichen, die eine historische Lesart zwar aufruft, zugleich aber subtil unterläuft. Denn spielt der Roman 1711 während des letzten großen Pestausbruches in Dänemark? Soll die ungenannte Hauptstadt am Sund, wo Zoll die Haupteinnahmequelle des ungenannten Königs ist, Kopenhagen sein? Aber wie passt eine solche Datierung z.B. zu expliziten Anachronismen wie Wasserklosetts oder dem einleitend bereits zitierten Vergleich mit einem Sack Kartoffeln?
Langballe schreibt ihren Roman in eine ganz andere Tradition als den historischen Roman ein, der als sine qua non nicht auf einen extrareferentiellen, historischen Bezug verzichten kann. elskende‘s ‚historisches‘ Universum ist vielmehr ein intertextuelles: Schon die Kombination aus Erzählen, Sexualität und Pest ruft Boccacios Decamerone als einen Grundtext abendländischen Erzählens auf, und die dänische Literaturkritik hat zudem nicht gezögert, elskende in eine Blixen’sche Tradition zu stellen.3 Wobei hinzugefügt werden muss, dass der Roman elskende zwar oberflächlich an Karen Blixen gemahnen mag: mit seiner Handlung, die zudem in einer unbestimmbaren, wenn auch nicht allzufernen Vergangenheit angesiedelt ist; mit den adligen Handlungsträger:innen mit ihrer Verachtung für bürgerliche Moralvorstellungen; und mit der binnentextuellen Selbstdeklaration als Maskenspiel, dessen Masken am Ende fallen („men de falder for øjne, der ikke længere vil se“ [aber sie fallen vor Augen, die nicht länger sehen wollen] (S. 202)). Markierte intertextuelle Bezüge weist der Roman jedoch nicht zu Blixens Werken auf. ‚Blixen‘ wird eher als Horizont einer spezifischen europäischen wie dänischen Erzähltradition aufgerufen, eines weder (sozial-)realistischen noch autofiktionalen Schreibens, als Plädoyer für die Freude am (wohlstrukturierten) Fabulieren und die Möglichkeiten von Fiktionalität.
Liebend(e)
Sollte der Roman in andere Sprachen übersetzt werden, werden die Übersetzer:innen mit der Doppeldeutigkeit des Titels zu kämpfen haben: elskende, signifikanterweise als Titel klein geschrieben, kann im dänischen sowohl ein Substantiv (‚Liebende‘) als auch ein Partizip (‚liebend‘) sein. Doch ist der Titel, der ein Buch mit pastellfarbenem Umschlag und einer seichten Liebesgeschichte verheißt, nicht nur doppeldeutig, sondern zugleich auch zutiefst ironisch. Denn wo ist die Liebe, wo können die Liebenden in diesem Roman sein, der wesentlich in einem Bordell spielt?
Romantisiert wird das Leben im Bordell wahrhaftig nicht. Gunhild und Ester, die Bordellschwestern der Ich-Erzählerin, sind aus „fattigdom og uheld“ [Armut und Unglück] (S. 78) im Bordell gelandet. Von Ester erfahren wir en passant, dass sie ihr Dasein nur mit Alkohol betäubt aushält; von Gunhild, dass sie ihren Vater nach einem Schlaganfall im Wald aussetzte, damit der Rest der Familie genug zum Essen hatte. Als Gunhild schwanger wird vom König, der sie beim Sex sadistisch prügelt, versucht sie das Kind vergeblich mit Hilfe eines Kräutersuds abzutreiben.
Während die Frauen Namen tragen, bleiben die Männer alle namenlos. „[D]e er ikke lige så vigtige for historien“ [Sie sind nicht gleichermaßen wichtig für die Geschichte“] (S. 10), äußert die Ich-Erzählerin schon früh. Es sind erbärmliche, von Frauen unbegehrte Männer, bei denen Sex und Gewaltausübung nahtlos ineinander übergehen können: „Hvad vil det sige at tage i besiddelse? At besidde noget, virkelig eje det, er muligvis at mishandle det. Måske har du ikke ejet noget, før du har slået skår af det og konstateret, at det stadig er dit.“ [Was heißt es, etwas in Besitz zu nehmen? Etwas zu besitzen, wirklich sein eigen zu nennen, ist möglicherweise, es zu misshandeln. Vielleicht hast du etwas erst dann wirklich besessen, wenn du es zerbrochen und festgestellt hast, dass es immer noch dir gehört.] (S. 60)
Allerdings ist für die Ich-Erzählerin der schweißig-sinnliche Sommer im Bordell, in dem sie, wie es einleitend heißt, „et helt liv“ [ein ganzes Leben] (S. 8) gelebt habe, keine reine Opfer- und Leidensgeschichte. Zumindest streckenweise dokumentiert ihre Beiche in elskende auch eine Geschichte der Selbsterkenntnis, sowohl in Bezug auf ihre eigene Sexualität als auch in Bezug auf ihr eigenes moralisches Verhalten. „Man chokeres altså ikke over, at disse mænd gør, som de gør; man chokeres over at forstå, at man havde gjort det samme i deres sted. Det er ikke i uforståeligheden, men i genkendelsen, at det svære består.“ [Man ist also nicht schockiert darüber, dass diese Männer so handeln, wie sie es tun; man ist schockiert darüber zu verstehen, dass man an ihrer Stelle dasselbe getan hätte. Nicht in der Unverständlichkeit, sondern im Wiedererkennen liegt das Schwierige.] (S. 66) Ja, die Gewalt „kryber ind i folk om natten som arrige skovsnegle, der må udspyes i løbet af dagen. Det er også hændt, at den er krøbet ind i mig“ [schleicht sich nachts in Menschen ein wie wütende Wegschnecken, die tagsüber ausgespuckt werden müssen. Es ist auch schon vorgekommen, dass sie sich in mich eingeschlichen hat]. (S. 62)
Sex wird im Bordell ökonomisiert, indem er der Herrschaft von Angebot und Nachfrage unterworfen wird. Im Gegensatz zu anderen „transaktionelle forhold“ [transaktionellen Beziehungen] (S. 143) der heraufdämmernden kapitalistischen Gesellschaft sind die Frauen aber sowohl Ware als auch Verkäuferin (S. 48), die sich einen Teil ihrer – auch körperlich-sexuellen – agency bewahren. Das Außen-vor-sein der Huren wird von der namenlosen Ich-Erzählerin selbstbewusst als Freiheit gedeutet: „Vi træder ud af kvindernes fællesskab, selvom vi ikke bliver budt velkommen i mændenes. Vi er mellem sfærer, vi er kometer. Vi kan ejes af alle, så vi ejes af ingen, og det er frihed.“ [Wir treten aus der Gemeinschaft der Frauen aus, auch wenn wir in der Gemeinschaft der Männer nicht willkommen sind. Wir befinden uns zwischen den Sphären, wir sind Kometen. Wir können von allen besessen werden, also gehören wir niemandem, und das ist Freiheit.] (S. 122)
Von Anfang an ist die Ich-Erzählerin allerdings besessen von Pickeln, Blasen und Beulen, selbst von Pestbeulen. Die fast schon leitmotivisch den Roman durchziehende Manie, bei sich und anderen diese aufzukratzen oder aufzustechen und dann auszudrücken, ist unschwer als ein autoaggressiver Versuch der Selbstvergewisserung (wo es um den eigenen Körper geht), aber zunehmend auch als Reinigungsakt deutbar. Gegen Ende des Sommers ist ihr ganzer Körper von Spuren dieser Manie gezeichnet:
På mine egne overarme var der derfor fyldt med små sår, hvor jeg havde trykket små knopper ud. Også på mine ben var det lykkedes mig at lokalisere afløb af skidt. […]
Huden omkring mit skamben hang i laser, nogle af mændene kommenterede det.
[…]
Jeg begyndte at fantasere om at komme dybere ned. Tage hude af og rense kødet frit for talg og fedt. Adskille senere fra ben og brusk og tørre dem af med en nyvasket klud kun for at hæfte dem på plads igen. Skrubbe knoglerne (indædt) med en børste og polere dem, til de blev glatte.
Nu kan det lyde, som om jeg følte mig frygtelig beskidt, det gjorde jeg ikke. Jeg nød bare den lille smerte og at se ting komme ud af min krop. Det havde ikke noget at gøre med at være ren, egentlig. (S. 180)
[Meine eigenen Oberarme waren daher übersät mit kleinen Wunden, wo ich kleine Pickel ausgedrückt hatte. Auch an meinen Beinen gelang es mir, Ausläufe von Schmutz zu lokalisieren. […]
Die Haut um mein Schambein hing in Fetzen, einige der Männer kommentierten dies.
[…]
Ich begann davon zu phantasieren, tiefer hineinzukommen. Die Haut abzuziehen und das Fleisch von Talg und Fett zu befreien. Später von Knochen und Knorpel zu trennen und sie mit einem frisch gewaschenen Tuch abzuwischen, nur um sie wieder anzubringen. Die Knochen (hartnäckig) mit einer Bürste zu schrubben und zu polieren, bis sie glatt waren.
Das klingt jetzt vielleicht so, als hätte ich mich furchtbar schmutzig gefühlt, das tat ich nicht. Ich genoss einfach den leichten Schmerz und zu sehen, wie Dinge aus meinem Körper kamen. Das hatte nichts mit Sauberkeit zu tun, eigentlich.]
Eigentlich. Kurz bevor ihr Mann sie zurückholt, attestiert ihr ein Kunde, sie habe traurige Augen.
Immerhin gibt es eine Liebesgeschichte im Roman, aber mehr in der Peripherie der Beichte der Hofdame: die Beziehung zwischen Sunniva, der Frau zur linken Hand des Königs, und Viola, der Bordellwirtin, die in einer geheimnisvollen Beziehung mit der Zauber- und Elfenwelt steht. Wenn im Roman von „de elskende“ („die Liebenden“) die Rede ist, ist jedes Mal von diesen beiden die Rede. Doch ihre Liebesgeschichte ist eine unglückliche, denn auch wenn Sunnivas Liebe, die sie dem König entgegenbringt, nur „harsk og fodslæbende“ [harsch und schleppend] (S. 60) ist, mag sie doch letzten Endes ihr Leben im Schloss nicht für eine romantische Flucht mit der Geliebten aus ihrer Jugend aufgeben.
Der Rosenbusch in der Mitte des Labyrinths
Gibt es also Liebe(nde) in elskende? Die Lesenden werden im Roman einleitend aufgefordert, selbst ein Urteil zu fällen, ob es sich um eine Liebesgeschichte handelt:
Det er aldeles muligt, tror jeg, at hendes [= Violas] historie i virkeligheden handler om penge og drømme og en manglende forståelse for, at nogle gange er det for sent.
[…]
Hvis der er kærlighed her, håber jeg, at du finder den. (S. 10)
[Es ist absolut möglich, glaube ich, dass ihre [= Violas] Geschichte in Wirklichkeit von Geld und Träumen und einem Mangel an Verständnis handelt, dass es manchmal zu spät ist.
[…]
Wenn es hier Liebe gibt, hoffe ich, dass du sie findest.]
Erzähltopographisch findet diese Suche nach der Liebe, die den Lesenden als Aufgabe gestellt wird, ihren symbolischen Ausdruck in einem undurchschaubaren Labyrinth aus dichten Buchenhecken, das zwischen dem Schloss und dem Bordell liegt. Im Zentrum des Labyrinths soll „efter sigende“ [dem Hörensagen nach] (S. 10) die schönste Rose des Landes wachsen, deren Duft und Farbe wundersame Fähigkeiten nachgesagt werden. Obwohl das von den Gärtnern des Königs sorgsam gepflegte Labyrinth für alle frei zugänglich ist, geht doch niemand hindurch aus Angst, sich darin zu verirren. Sunniva und die Ich-Erzählerin unternehmen zwar einmal einen Spaziergang in dem Labyrinth, irren aber nur in diesem herum, ohne das Zentrum zu finden. Ohnehin bringe es, so der König, Unglück, bis zum Rosenbusch vorzudringen – sehen soll niemand die wunderschöne Rose, nur sich danach sehnen.
Für die vom König geschwängerte, unglückliche Gunhild wird der angeblich selbst während der Dürre dieses Sommers gewässerte herrliche Rosenbusch zum Hassobjekt, zum Symbol für die Ungerechtigkeit im Königreich. Sunniva hat leichtes Spiel, als sie der rachsüchtigen Gunhild angeblich den Weg zum Rosenbusch beschreibt, um sie dann im Labyrinth zu verbrennen zu versuchen. Der Merkreim für den Weg durch das Labyrinth, den sie Gunhild beibringt, hätte allerdings für diese eine Warnung sein können:
Højre, højre, venstre
Dum er den, der elsker
Venstre, venstre, højre
Elsk blot aldrig højere
End ligeud ligeud ligeud
Ellers finder du aldrig ud (S. 187)
[Rechts, rechts, links
Dumm ist, wer liebt
Links, links, rechts
Liebe bloß niemals stärker
Als geradeaus geradeaus geradeaus
Sonst findest du niemals heraus]
Gab es jemals einen Rosenbusch? Nachdem das Labyrinth niedergebrannt ist, ist er nicht mehr zu finden: „Man formodede, at rosen også brændte ned den nat. Væk var den i hvert fald.“ [Man vermutete, dass die Rose auch in jener Nacht niederbrannte. Jedenfalls war sie weg.] (S. 188) Mehr als suggeriert wird hier, dass es die Rose nie gegeben hat. Das von ihr symbolisierte Konzept der Liebe als und im Zentrum des (Lebens-)Labyrinthes wird so lesbar als ein Diskurs, der lediglich dem Machterhalt des Königs gedient hat. Der Glaube an die Liebe wirkt gesellschaftsstabilisierend, aber ob die Liebe selbst existiert, ist zweifelhaft. Wie hieß es schon in der metafiktionalen Vorrede ganz am Anfang dieses provokativen, ästhetisch geglückten, aber ach so pessimistischen ‚Liebesromans‘: „[I] labyrintens centrum er der tomt“ [Im Zentrum des Labyrinthes ist es leer] (S. 7).
(Stephan Michael Schröder, Universität zu Köln)
- „Det er, som om alle andre har fået en manual, og jeg har ikke“. In: Politiken, 3.10.2021. ↩︎
- Anna Raaby Ravn: „Politikens Lotte Folke om den træthed, der fik hende til at producere 45 minutters podcast om, ja, fortællingen om Mette Høeg“. In: Weekendavisen, 19.9.2025. ↩︎
- Benedicte Gui de Thurah Huang: „Som var Karen Blixen stået op fra de døde for at skrive om byldepest og hor“. In: Politiken, 2.6.2025. ↩︎